Benennen, Bewerten, Vergleichen – Überlebensstrategien unseres Egos

Ich sag jetzt nicht, wie der Autor heißt und wie gut der Artikel ist…
In Torsten Brügges Buch „Besser als Glück“ konzentriert er sich vor allem auf die Erfahrbarmachung meditativer Zustände. Seiner Überzeugung nach ist es hilfreich, darüber einen befreienden Abstand zum eigenen Denken zu bekommen. Dadurch, so Brügge, lösen wir uns von veralteten und rigiden Denkweisen und öffnen uns für neue Perspektiven, frische Sichtweisen und Lösungsmöglichkeiten. Für Brügge ist dafür eine „radikale“ Selbsterforschung unablässig. Sie entlarvt unser vermeintlich festes Ich-Gefühl als bloß flüchtige Erscheinung. Dahinter öffnet sich unsere Wahrnehmung für die spirituelle Dimension des Lebens. Aus ihr heraus finden wir Zugang zur tiefer Sinnerfüllung und nachhaltigem Lebensglücks. (Torsten Brügge)
Schwimmstile des sich identifizierenden Geistes
Die Natur jeden Gedankens ist es, von allein wieder in die Stille zurückzufallen, wie ein schwerer Gegenstand, der im Meer ganz von selbst nach unten sinkt. Würden wir das bewusst bemerken, so würde unser Bewusstseinsschwerpunkt mit in die Tiefe gerissen werden. Doch meist scheint es so, dass die Leid erzeugenden Gedanken der Identifikation keineswegs so schnell von alleine abtauchen. Es macht den Eindruck, sie blieben an der Oberfläche bestehen, und unser Ich-Gefühl bliebe dort mit ihnen hängen. Wie kommt das? Wie schafft es unser Geist, sich über Wasser zu halten? Wie hält er die anstrengende Identifikation mit dem Ich aufrecht?
Es ist wie beim Schwimmen. Nur durch heftiges Paddeln an der Oberfläche gelingt es unserem Geist, Auftrieb zu erzeugen, um nicht zu ertrinken. Doch seine Schwimmstile heißen nicht Kraulen, Brust- oder Rückenschwimmen, sondern Benennen, Bewerten und Vergleichen. Es sind diese mentalen Aktivitäten, die den Geist an der Oberfläche halten. Solange sie unbewusst ablaufen, merken wir nicht einmal, dass wir (geistig) schwimmen. Wir merken höchstens, dass wir uns abstrampeln und doch nirgendwo ankommen. Schauen wir uns aber genauer an, welchen Bewegungen wir bisher blind gefolgt sind, eröffnet sich uns die Möglichkeit, damit aufzuhören. Wir werden uns die Schwimmstile des Geistes im Einzelnen ansehen.
Benennen: Die Reduzierung der Lebendigkeit auf ein Symbol
Im folgenden Bewusstseinsexperiment können wir den Prozess des Benennens am Beispiel des Atmens erkunden.
Entspannen Sie sich, und gehen Sie mit Ihrer Aufmerksamkeit zum Ein- und Ausatmen.
Nehmen Sie wahr, wie sich Ihr Brustkorb beim Einatmen hebt und weitet und wie er sich beim Ausatmen wieder senkt.
Nehmen Sie einfach wahr, ohne etwas zu verändern, so als ob Sie am Strand liegen, auf das Meer schauen und beobachten würden, wie Wellen am Strand auflaufen und sich wieder zurückziehen.
Lassen Sie sich etwas Zeit für dieses entspannte Beobachten.
Und lassen Sie dann die benennende Funktion des Verstandes aktiv werden: Benennen Sie jede Phase des Atemzuges ganz bewusst mit den Gedanken »Dies ist Einatmen« und »Dies ist Ausatmen.«
Bleiben Sie für ein paar Atemzüge bei diesem Benennen, und beobachten Sie, wie sich Ihr Erleben verändert.
Unmittelbar zu erleben bedeutet, ohne Mittel zu erleben – auch ohne Mittel des Verstandes. Also, zum Beispiel, ohne eine Erfahrung zu benennen. In dieser Unmittelbarkeit des Spürens zeigt sich selbst in der einfachsten Wahrnehmung – wie der des Atmens – eine entspannte Lebhaftigkeit und befriedigende Fülle. Diese friedvolle Lebendigkeit existiert vor jeglicher Benennung. Der Kontrast macht deutlich, dass das Benennen eingeschränkt und trocken wirkt. Die dynamische Erfahrung wird mit dem sprachlichen Begriff »Dies ist Atmen« ergriffen, eingeschlossen und verhärtet.
Untersuchen wir diesen Prozess auch in Bezug auf visuelle Reize:
Nehmen Sie eine Sitzhaltung ein, in der Sie sich wohl fühlen. Schließen Sie für ein paar Minuten die Augen, und entspannen Sie sich.
Dann öffnen Sie die Augen langsam und schauen mit weichem Blick nach vorne, ohne einen bestimmten Gegenstand zu fokussieren.
Werden Sie sich einfach bewusst, dass Farben und Formen auftauchen. Sie brauchen Ihren Blick auf nichts zu fokussieren, aber wenn Fokussierung stattfindet, können Sie auch das geschehen lassen. Nehmen Sie die Formen, Umrisse, Farben wahr, ohne sie zu benennen. Werden Sie sich auf diese Weise Ihres gesamten Blickfeldes gewahr. Vielleicht stellen Sie fest, dass im Zentrum die optische Wahrnehmung schärfer ist, während am Rand die Dinge weicher gezeichnet sind. Bleiben Sie für ein paar Minuten mit dieser offenen Wahrnehmung, diesem weichen Blick. Lassen Sie das Bild vor Ihren Augen ohne Worte auf sich wirken.
Dann lassen Sie die benennende Funktion Ihres Verstandes auftauchen. Benennen Sie bewusst die Formen und Farben, die Sie sehen. Vielleicht gibt es konkrete Gegenstände, dominierende Farbnuancen oder verschiedene Oberflächen.
Richten Sie Ihre Aufmerksamkeit für einige Minuten auf diese Aktivität des Findens von Namen und Bezeichnungen.
Was unterscheidet das »Benennen« von der Phase des weichen Blickes
Nun lassen Sie diese Aktivität des Benennens wieder zur Ruhe kommen. Kehren Sie zurück zur wortlosen Wahrnehmung.
Jetzt muss nichts mehr definiert oder eingeordnet werden. Nehmen Sie einfach das unmittelbare Sehen wahr. Es geschieht von selbst.
Nehmen Sie die Qualität wahr, die Stimmung, die mit dieser einfachen Wahrnehmung einhergeht.
Sie können diesen Wechsel zwischen den beiden Phasen (»weicher Blick« und »Benennung«) zwei- bis dreimal in Ruhe wiederholen.
Die Phase des weichen Blickes lädt dazu ein wahrzunehmen, wie abwechslungsreich der visuelle Eindruck eines Momentes sein kann. Unabhängig davon, was wir gerade sehen, vor unseren Augen stellt sich ein fantastisches Kaleidoskop von Färbungen, Lichtreflexen, Helligkeitsstufen und Kontrasten dar. Wenn unser Verstand sich von der Aktivität des ständigen Benennens entspannt, wird die Faszination und Anmut dieses Bildes bewusst. Vielleicht bemerken wir, dass selbst der Anblick einer gewöhnlichen Tischplatte, einer Teetasse oder eines Telefons vollendete Ästhetik offenbart. Eine strahlende Farbe hier, ein auffallender Kontrast da, eine Lichtspiegelung dort. Ohne das Gewicht der Definition zeigt sich eine unerwartete Schönheit, ein überraschender Glanz in allem, was in unserem Blickfeld erscheint.
Vielleicht wird uns auch klar, wie schnell die Reaktion des Benennens abläuft. In Sekunden bietet uns der Verstand Bezeichnungen für das Gesehene an. Mehr noch, er drängt sie uns förmlich auf. Da das Benennen und Kategorisieren eine tief verankerte Konditionierung ist, macht es keinen Sinn, es ausschalten zu wollen – das wäre nur eine weitere Anstrengung. Stattdessen können wir sehen, was sich zeigt, bevor der Verstand den Bezeichnungen Gewicht und Bedeutung verleiht. Tauchen in der Phase des weichen Blicks Benennungen auf, ist es weder nötig, sie zu unterdrücken noch ihnen Aufmerksamkeit zu schenken. Wir brauchen den Gedanken über Namen und Formen nicht zu folgen und können zur schlichten Schönheit des direkten Erlebens zurückkehren.
Im Benennen wird deutlich, wie der Verstand Formen aus dem Gesamtbild zu identifizieren beginnt. Auf Grund seiner Erfahrung ist er in der Lage, Gestalten, Umrisse, Farben zu erkennen und zu abgespeichertem Wissen in Beziehung zu setzen. Der Name eines Objektes wird als Gedanke bewusst: »Tisch«, »Fenster«, »Teppich«. Diese Verstandesfunktion unterteilt das Gesamtbild in lauter getrennte Einzelteile. Mit dem weichen Blick sehen wir das Bild vor uns eher als Ganzes, als Gemälde, dessen Teile eine untrennbare, harmonische Einheit bilden.
Im Prozess der Namensgebung spüren wir wieder die Einschränkung der lebendigen Erfahrungswelt ins Korsett mentaler Abbilder. Die Begriffe sind wie geistige Kartons mit Etiketten. Die Sinneseindrücke werden einsortiert. So werden sie für den Verstand wieder greifbare Objekte. Sie können gelagert, transportiert, ausgetauscht werden. Doch diese Kartons sind nicht so lebendig wie die unmittelbare Erfahrung. Ein Orange kann wunderbar warm strahlen, ein Grün als Inbegriff von Lebenskraft leuchten, ein goldenes Schimmern kann uns entzücken, der Umriss des Mondes am Nachthimmel vermag uns zum Staunen zu bringen. Die geistigen Kartons mit den Etiketten »Orange«, »Grün«, »Gold«, »sichelförmig« haben alle dieselbe kartongraue Farbe und monotone rechteckige Form.
Nichtsdestotrotz bleibt die Fähigkeit des Benennens eine nützliche Funktion. Entscheidend ist, ob wir uns dieser Funktion als Mechanik des Geistes bewusst sind. Sind wir es nicht, bleiben wir dem Irrglauben verhaftet, die Welt sei so, wie der Verstand sie sich einbildet. Dann halten wir die symbolischen Begriffe, die Gedanken über Objekte und Formen für die Realität selbst. Dann sind wir im Mythos gefangen, in der Welt gebe es konkrete und feste Objekte. Und auch unser eigenes Sein als Körper und Person nehmen wir als eine Art festen Gegenstand wahr, der vom Rest der Welt getrennt ist. Wir übersehen, dass unsere Empfindungen, Gefühle und Vorstellungen einen sich stetig wandelnden Fluss von Erfahrungen darstellen, in dem nirgends ein festes Ich auszumachen ist.
Ist uns dagegen das Benennen als mentaler Prozess bewusst, dann können wir die tiefere Dimension erahnen, die die ganze Zeit als stiller Hintergrund gegenwärtig ist. Vor, während und nach dem Auftauchen mentaler Begriffe und Symbole vibriert da diese kaum spürbare, hochfeine Schwingung einer grenzenlosen, friedvollen Weite. Sie ist unser wahres Sein und begleitet das Auftauchen und Verschwinden jeglicher mentalen Erfahrung mit der Ruhe wortloser Stille.
Bewerten: Der Geist als ewig nörgelnder Perfektionist
Die Benennung macht aus der unmittelbaren Erfahrung mentale Objekte. Das Bewerten folgt ihr auf dem Fuße. Bewerten bedeutet: Unser Geist erstellt eine Skala und misst alles daran. Auch diese Verstandesfunktion war evolutionär von Vorteil. Wenn wir über das mentale Abbild eines »Astes« verfügen und ihm eine Eigenschaft wie »Stabilität« zuordnen, können wir seine Belastbarkeit messen. Die Kategorisierung »Ein Ast trägt zwei schwere Steine« ermöglicht Berechnungen für eine komplexere Konstruktion aus Ästen. Bewerten und Messen sind also fundamentale Verstandesfunktionen, besonders für das technische Denken.
Doch darauf beschränkt sich diese Funktion des Verstandes nicht. Sie trägt noch zu etwas anderem bei: Sie hält uns in der Gefangenschaft des Leidens.
Wie bereits gesagt, beginnt der erste Schritt der Identifikation mit dem Gedanken: »Ich bin dieser Körper.« Die Funktion des Benennens verfestigt diesen Glauben, weil sie den Strom unmittelbarer Erfahrung in einer mentalen Symbolwelt festschreibt. Damit einher geht das Gefühl einer grundlegenden Unzufriedenheit. Wenn wir glauben, unser wirkliches Ich sei der Körper, engen wir unser Seinsgefühl erheblich ein. Ohne Identifikation haben wir ein natürliches Gespür für die grundlegende Einheit und Fülle aller Dinge und ruhen in der Erfüllung des stillen Gewahrseins. Mit der Identifikation scheint es ein reales »Ich« und damit auch ein reales »Du« und eine »Welt« zu geben. Von diesem Gegenüber fühlen wir uns jedoch abgetrennt. Wir haben das Gefühl, etwas würde fehlen.
Wir sind uns der Ursache für dieses Leiden, unserer Fehlidentifizierung, allerdings nicht bewusst. Deshalb projizieren wir die Gefühle des Mangels und der Angst auf das, was wir zu kennen glauben: auf unser persönliches Ich. Dies wird in den negativen Bewertungen deutlich, die wir uns immer wieder selbst vorhalten: »Mein Körper ist alles andere als perfekt.« »Ich bin nicht liebenswert genug.« »Ich bin zu langsam.« »Ich müsste interessanter für andere sein.«
Auch wenn wir ein vergleichsweise neutrales Selbstbild haben, ist das Gefühl des Mangels nie ganz abwesend. Es hat sich nur anders verkleidet: »Ich bin intelligent, nur mein Wissen reicht nicht.« »Ich fühle mich eigentlich ganz gut, aber es könnte sicher besser sein.« »Wenn ich nur mehr Charme hätte …« Nie zufrieden zu sein stellt ein Charakteristikum des sich identifizierenden Geistes dar. Er ist ein ewiger Perfektionist. »Nicht gut genug«, »noch ein bisschen mehr«, »ein wenig besser«, »etwas höher« sind seine typischen Nörgeleien.
Natürlich sind wir manchmal von uns überzeugt und besitzen in einigen Bereichen Selbstvertrauen. Dann verspüren wir Stolz: »Mein Körper sieht doch wirklich gut aus.« »Ich bin ein witziger und intelligenter Typ.« Allerdings sitzt uns dabei eine diffuse Furcht im Nacken. Es ist die Basis-Angst der Identifikation. Insgeheim fürchten wir uns davor, jemand anders könnte doch schöner, besser oder schlauer sein, oder wir könnten die hoch geschätzten Eigenschaften wieder verlieren. Denn im Inneren wissen wir um das Gesetz der Vergänglichkeit, das auch nicht Halt machen wird vor den erfreulichen Eigenschaften des Körpers, vor guten Stimmungen und einem intelligenten Verstand.
Im folgenden Experiment schauen wir uns an, wie es sich anfühlt, den eigenen Körper zu bewerten.
Nehmen Sie sich Zeit, zur Ruhe zu kommen. Wenn Sie mögen, schließen Sie die Augen. Lassen Sie alle Aktivität im Geist los.
Genießen Sie einfach die Entspannung in diesem Moment. Dann lassen Sie den Gedanken aufsteigen: »Ich bin dieser Körper.«
Werden Sie sich dabei Ihres Körpers gewahr.
Spüren Sie die Füße und Beine, den Rumpf und den Rücken, die Arme und Hände, die Schulter, den Hals und den Kopf.
Spüren Sie Ihren ganzen Körper und seine Grenzen zu der ihn umgebenden Welt.
Und nun lassen Sie im Geist die Frage auftauchen: »Empfinde ich meinen Körper als schön?« Sie können sich innerlich einige Male vorsagen: »Empfinde ich meinen Körper als schön?«, und spüren Sie nach:
Welche Körperempfindungen treten mit dieser Frage auf? Welche Stimmungen und Gefühle schwingen mit?
Welche Gedanken oder Assoziationen tauchen auf? Beobachten Sie, was Sie in Ihrem Inneren mit dieser Frage erleben.
Dann lassen Sie die Aktivität des Fragens und Bewertens wieder zur Ruhe kommen.
Genießen Sie für ein paar Minuten die Stille des Geistes, wenn Sie nicht über Ihren Körper nachdenken.
Bei der Frage, »Empfinde ich meinen Körper als schön?«, können wir beobachten, wie der Verstand bewertet. Wir werden uns jener Bereiche bewusster, die für unsere Vorstellung von körperlicher Schönheit Bedeutung haben. Wir sehen, wie unser Verstand zuerst Körperbereiche und Eigenschaften benennt. Im nächsten Schritt hat er schon eine Skala zur Hand. Sie sieht ungefähr so aus: abstoßend – hässlich – mittelmäßig – neutral – schön – ideal. Und dann folgen die Messergebnisse: »Mein Bauch ist immer noch zu dick.« »Mein Haar ist ganz okay.« »Meine Haut ist toll gebräunt.«
Wie fühlt sich dieses Bewerten an? Schwingt nicht unterschwellig immer ein Gefühl der Minderwertigkeit mit – »Das ist nicht gut genug, es könnte besser sein, da fehlt noch was«? Dieses elementare Gefühl der Unzulänglichkeit und Unvollkommenheit ist der Ausdruck des Basismangels, es ist die krank machende Begleiterscheinung jeglicher Identifikation.
Dabei bedarf unser Körper keineswegs der Verbesserung. In Wahrheit ist er perfekt, genauso wie er ist – in diesem Moment. Aus der Perspektive des Ozeans hat jede Welle ihre ureigene Schönheit. Doch wenn sich unsere Aufmerksamkeit im Strudel von Bewertungen verliert, übersehen wir die stille Perfektion, die bereits jetzt allem innewohnt. Wir glauben dann, wir müssten die Vollkommenheit selbst wiederherstellen, zum Beispiel indem wir unseren eigenen Körper oder unsere Persönlichkeit perfektionieren. Das ist die beste Garantie für dauerhafte Frustration.
Dabei ist die tief greifende Zufriedenheit, die wir suchen, ganz nah. In dem Moment, da wir uns vom Nachdenken über die Eigenschaften unseres Körpers entspannen, können wir befreit aufatmen. Wenn wir uns nicht mental mit unserem Körper beschäftigen, spüren wir eine erstaunliche »körperlose« Leichtigkeit. Das ist die wirkliche Leichtigkeit des Seins – ohne Definitionen, ohne Identifikation, ohne Vorstellungen von uns als leiblichem Wesen.
Vergleichen: Auf der Streckbank der Idealbilder
Der nächste mentale Prozess, den wir unter die Lupe nehmen wollen, ist das Vergleichen. Tatsächlich ist Vergleichen schon Teil der Bewertung. Eine Bewertung kann nur vorgenommen werden, wenn wir zwei Eindrücke haben und sie nebeneinander stellen. Sobald unser Verstand eine Bewertung vornimmt, gibt es auch ihr Gegenstück. Finden wir etwas schön, muss es auch etwas Hässliches geben. Glück gibt es nicht ohne Pech, Gutes nicht ohne Schlechtes, immer in dynamischem Wandel und gegenseitiger Balance. Im chinesischen Yin-Yang-Symbol gehören Schwarz und Weiß zueinander wie Spiegelbilder, mal dominiert das Dunkle, mal das Helle, doch das eine ist nicht ohne das andere denkbar. Das ist das Gesetz der Dualität. In der Welt des Verstandes ist es unumstößlich.
Tief im Inneren ahnen wir, dass es eine umfassende Vollkommenheit und Schönheit des Lebens geben muss, die über dieses Gesetz hinausgeht. Doch wir haben unseren denkenden Geist zur höchsten Instanz erhoben und glauben an seine Festlegungen. Und diese sind immer in den dualistischen Gegenpolen gefangen. Deshalb projizieren wir unsere Sehnsucht nach Perfektion auf den hellen Pol. Wir sind der Überzeugung, alles müsse weiß, positiv, angenehm und leicht sein. Wir setzen alles daran, unsere Lebensumstände und unsere Persönlichkeit solchen imaginären Bildern der Vollkommenheit anzugleichen. Das ist der Beginn einer langen Odyssee auf dem Meer der dualistischen Erfahrungen.
Wir glauben uns an einem Punkt A, der sich nicht gut genug anfühlt. Wir schwimmen los zum Punkt B, der in der Ferne Glück versprechend glänzt. Dort muss die Erfüllung warten, dort ist Licht und Frieden zu finden – diese Hoffnung ist unser Antrieb. Doch es gibt kein Ankommen. Oder nur scheinbar und lediglich für kurze Zeit. Denn schnell erweist sich das, was aus der Ferne lockte, wieder als fade und unbefriedigend. Punkt B scheint dem Punkt A sogar sonderbar zu ähneln. Und so ist es. An der Oberfläche ist jeder Punkt dem dualistischen Wandel unterworfen. Also weiter auf der unendlichen Reise. Punkt C sieht so verlockend aus. Unsere Devise lautet: »Die Hoffnung stirbt zuletzt.«
Alles, was wir mit unserem Herumschwimmen erreichen, ist, dass wir nicht untergehen. Doch ausgerechnet das Untergehen wäre die Lösung. Die Loslösung von der mühsamen oberflächlichen Suche. Das Versinken in die Erkenntnis der erfüllten Einheit.
Am deutlichsten wird unsere ungestillte Sehnsucht in den Idealbildern, die wir uns eingeprägt haben. Geformt werden diese durch biologische Überlebensmuster, geschlechtsspezifische Wertvorstellungen, durch politische und religiöse Normen, durch kulturelle Denksysteme und Ideologien. Manche davon bringen wir schon in unseren Genen mit auf diese Welt, andere inhalieren wir mit der Erziehung in der Familie oder sie werden uns durch die Medien, in der Schule und im Beruf vermittelt. Idealbilder müssen nicht notwendig Leid erzeugen. Auch sie haben ihre Funktion in der Entwicklung der Psyche. Zum Leiden führen sie, wenn wir sie unbewusst benutzen, um wahrhaftige Erfüllung zu finden. Um das Leiden am Basismangel unserer Identifizierung zu beheben, ist kein Ideal, kein Hoffnungsbild, kein Ziel geeignet. Denn in den Phänomenen der oberflächlichen, dualistischen Welt kann es Frieden, Beständigkeit und Vollkommenheit nicht geben.
Sehen wir uns an, wie sich die erfolglose Jagd nach Glück in unserem Geist anfühlt. Am deutlichsten zeigt sie sich in der Verstandesfunktion des Vergleichens. Beim folgenden Experiment zu unseren Idealbildern können wir diese Aktivität live beobachten.
Nehmen Sie sich einen Moment Zeit zum Innehalten. Wenn Sie mögen, schließen Sie die Augen. Lassen Sie alles Nachdenken zur Ruhe kommen.
Die folgenden Fragen dienen als eine Art Sonde. Achten Sie beim Lesen auf die Resonanz in Ihrem Inneren.
Wie sollte mein Körper aussehen?
Werden Sie sich gewahr, welche Empfindungen und welche Stimmung mit dieser Frage auftauchen. Beobachten Sie, welche Fantasien und inneren Bilder in Resonanz zur Frage erscheinen.
Lassen Sie sich Zeit.
Dann lassen Sie sie wieder aus Ihrem Bewusstsein verschwinden.
Erlauben Sie sich, ohne jegliche Ideen darüber zu sein, was Ihnen fehlt oder wie Sie sein sollten.
In diesem Wechsel von Fokussierung auf die Frage und Entspannung vom Denken können Sie sich auch die folgenden Fragen stellen:
Was müsste sich an meiner Persönlichkeit ändern? Welches Wissen, welche Kenntnisse brauche ich noch? Wie müssten meine Beziehungen aussehen, damit ich zufrieden wäre?
Wann immer sich unser Verstand mit Wünschen oder Zielen in Bezug auf unser persönliches Ich beschäftigt, tut er Folgendes: Er konstruiert zunächst ein Selbstbild. Er erzeugt eine Zusammenstellung mentaler Entwürfe: Bilder von der Gestalt unseres Körpers, von unserem typischen Verhalten im Kreis von Freunden oder an unserem Arbeitsplatz, Erinnerungen an vergangene Ereignisse unseres Lebens, Einschätzungen und Aussagen anderer Menschen über unsere Person und vieles mehr.
Das läuft mit ungeheurer Geschwindigkeit ab. So schnell, dass wir es meist nicht bemerken. Aber wenn wir genau hinsehen, können wir es wie einen Kinofilm vor unserem inneren Auge sehen. Hier ein kurzes Standbild, wie wir unser Gesicht betrachten. Gleich darauf eine bewegte Sequenz, wie wir uns im Streit mit einer Freundin verhalten haben. Dann eine Einblendung mit einer unangenehmen Erfahrung in unserer Kindheit. Und jetzt wieder ein Schnitt: Wir werden in einer mündlichen Prüfung befragt und wissen keine Antwort.
Der Aufbau unseres Selbstbildes geschieht auch mit vorformulierten Gedanken: »Ich bin ein männlicher Typ.« »Ich bin ziemlich temperamentvoll.« »Ich habe ein gutes räumliches Vorstellungsvermögen, aber wenig Allgemeinwissen.« Mit dieser Abfolge von Bildern und Gedanken versucht unser Verstand, eine fest umrissene Person aufzubauen: »Das macht mich aus. So bin ich. Das bin ich.«
Ein weiterer Bereich, für den sich unser Verstand begeistert, ist die Spielwiese der Idealbilder. Das sind ebenfalls innere Vorstellungen, und sie verkörpern machtvolle Symbole des Glücks.
Wir sehen vielleicht die Figur einer Claudia Schiffer vor uns oder das coole Auftreten eines Brad Pitt. Wir malen uns aus, dass wir die charismatische Ausstrahlung eines George Clooney besitzen, ein geniales Einstein-Gehirn oder die Aura der Weisheit des Dalai Lama. Unser Geist jongliert mit einem Gedankensammelsurium von »Wenn ich wäre, hätte, könnte … «. Die Verheißungen einer zukünftigen Vollendung üben eine magische Anziehungskraft auf uns aus. So wohnen zwei Seelen in unserer Brust: ein mängelbehaftetes Selbstbild auf der einen Seite und ein fantasiertes, hoffnungsschwangeres Ideal auf der anderen. Das führt zu einer enormen inneren Spannung. Wir finden uns in der Folterkammer des perfektionistischen Geistes wieder und liegen auf der Streckbank. Unser Geist versucht, das unwerte, zu klein geratene Selbstbild dem großen Ideal anzugleichen, indem er an der Kurbel der Persönlichkeitsveränderung zerrt und immer wieder zwanghaft vergleicht. Er hofft, die eigene Person endlich dem glanzvollen Vorbild angleichen zu können. Diese Hoffnung verspricht Erlösung, doch in Wahrheit ist sie eine Qual. Sie ist pures Leiden. Unser Geist ist ein dilettantischer Folterknecht, der sich als seriöser Schönheitschirurg aufspielt.
Das Benennen und Bewerten ist die Einstiegsdroge in die siechende Welt der Dualität. Die Idealbilder und der Vergleich damit sind der Stoff, der süchtig macht. Doch wie bei jeder Droge wird das Gefühl des Mangels auch hier nur oberflächlich und kurzfristig gedämpft. Im Grunde verstärkt sich nur die Sucht der Suche.
Wenn sich dagegen unser Geist vom Benennen, Bewerten und Vergleichen entspannt, machen wir eine erstaunliche Entdeckung. Wir brauchen keine Anstrengungen zu unternehmen, um einem Idealbild hinterherzurennen. Es ist nicht einmal nötig, dass wir uns als ein persönliches Ich und dessen Eigenschaften definieren. Wir sind schon – auch ohne Vorstellungen von uns als Individuum. Dieses einfache unpersönliche Sein fühlt sich zutiefst zufrieden und ganz an. Ihm fehlt absolut nichts. Es ist – wir sind – vollkommen.
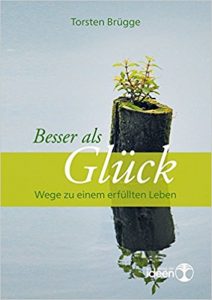 Torsten Brügge: Besser als Glück. Wege zu einem erfüllten Leben. Verlag der Ideen, 396 Seiten, € 19,90
Torsten Brügge: Besser als Glück. Wege zu einem erfüllten Leben. Verlag der Ideen, 396 Seiten, € 19,90

