Die verzagte Zunft
 Um nichts Falsches zu sagen, produzieren vormals textstarke Sänger zum großen Teil nichtssagende Lieder — umso mehr lohnt es sich, die Ausnahmen zu betrachten. Was ist ein Kabarettist? Jüngere Menschen würden diese Frage vielleicht so beantworten: eine Berufsgruppe, die Spott über Oppositionelle ausgießt und damit die Regierungsnarrative stärkt. Dass dies früher mal ganz anders war, wissen nicht mehr alle. Über Liedermacher und Exponenten der deutschen Rock- und Popmusik lässt sich im Prinzip Ähnliches sagen. Der Unterschied ist: Im Gegensatz zum politischen Kabarett haben Künstler des Singer/Songwriter-Genres die Möglichkeit, auszuweichen. Auf Privates zum Beispiel, auf das gehobene Liebeslied und das ästhetische Spiel mit Worten. Wenn es doch mal kritisch sein soll, die Kritik an der gegenwärtig herrschenden Politik jedoch in Zeiten von Cancel Culture zu gefährlich erscheint, bietet sich Kritik an Unrechtsregimen der Vergangenheit an. Oder — derzeit besonders beliebt — an „Rechten“. Damit signalisiert man gegenüber Publikum und Presse politisches Engagement, ohne die wirklich heißen Eisen anpacken zu müssen. Das Schaffen der textstarken Musikszene der letzten Jahre kann deshalb als eine einzige große Ausweichbewegung verstanden wer. „Ich sage besser nichts Präzises, dann sage ich auch nichts Falsches.“ Als Gegenbewegung radikalisiert sich eine dezidiert konservative, migrationskritische Liedermacherszene, die meist unter dem Radar der breiten Öffentlichkeit bleibt und vielfach über ihr Ziel hinausschießt. Eine wirklich mutige, künstlerisch wertvolle, umfassend humane Gegenwartskultur ist in dieser Gemengelage nicht leicht zu finden. Umso wichtiger ist es jedoch, danach zu suchen. Anmerkung der Redaktion: Da sich die vielen Musikvideos, die in diesem Beitrag eingebettet sind, nicht auf HdS übertragen lassen, verlinken wir hier nur, anstatt ihn als eigenen Beitrag zu bringen. Roland Rottenfußer
Um nichts Falsches zu sagen, produzieren vormals textstarke Sänger zum großen Teil nichtssagende Lieder — umso mehr lohnt es sich, die Ausnahmen zu betrachten. Was ist ein Kabarettist? Jüngere Menschen würden diese Frage vielleicht so beantworten: eine Berufsgruppe, die Spott über Oppositionelle ausgießt und damit die Regierungsnarrative stärkt. Dass dies früher mal ganz anders war, wissen nicht mehr alle. Über Liedermacher und Exponenten der deutschen Rock- und Popmusik lässt sich im Prinzip Ähnliches sagen. Der Unterschied ist: Im Gegensatz zum politischen Kabarett haben Künstler des Singer/Songwriter-Genres die Möglichkeit, auszuweichen. Auf Privates zum Beispiel, auf das gehobene Liebeslied und das ästhetische Spiel mit Worten. Wenn es doch mal kritisch sein soll, die Kritik an der gegenwärtig herrschenden Politik jedoch in Zeiten von Cancel Culture zu gefährlich erscheint, bietet sich Kritik an Unrechtsregimen der Vergangenheit an. Oder — derzeit besonders beliebt — an „Rechten“. Damit signalisiert man gegenüber Publikum und Presse politisches Engagement, ohne die wirklich heißen Eisen anpacken zu müssen. Das Schaffen der textstarken Musikszene der letzten Jahre kann deshalb als eine einzige große Ausweichbewegung verstanden wer. „Ich sage besser nichts Präzises, dann sage ich auch nichts Falsches.“ Als Gegenbewegung radikalisiert sich eine dezidiert konservative, migrationskritische Liedermacherszene, die meist unter dem Radar der breiten Öffentlichkeit bleibt und vielfach über ihr Ziel hinausschießt. Eine wirklich mutige, künstlerisch wertvolle, umfassend humane Gegenwartskultur ist in dieser Gemengelage nicht leicht zu finden. Umso wichtiger ist es jedoch, danach zu suchen. Anmerkung der Redaktion: Da sich die vielen Musikvideos, die in diesem Beitrag eingebettet sind, nicht auf HdS übertragen lassen, verlinken wir hier nur, anstatt ihn als eigenen Beitrag zu bringen. Roland Rottenfußer
https://www.manova.news/artikel/die-verzagte-zunft


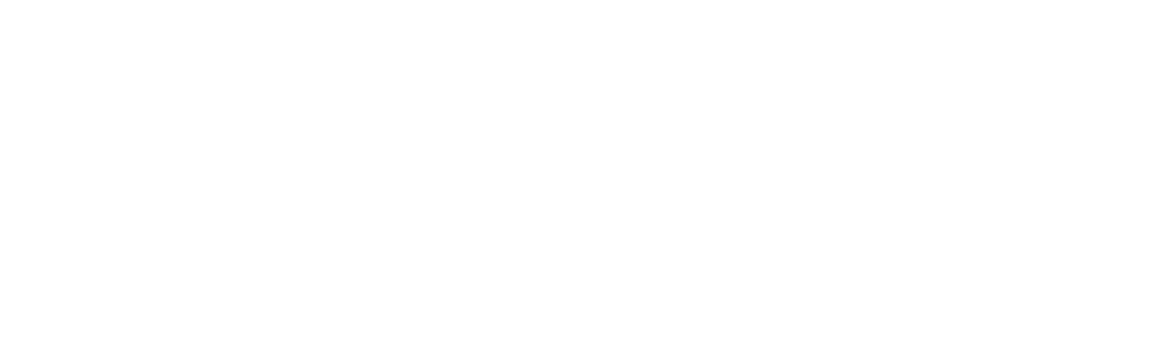
 Liebe Leserinnen und Leser von Hinter den Schlagzeilen, unser Magazin wird zwischen Mitte und Ende Juli seinen „Betrieb“ einstellen. Die Begründung hierfür steht in meinem Artikel, den ich unten noch mal angehängt habe. Von morgen, 15.06., bis Sonntag, 30.06., werde ich meinen ersten Urlaub seit Weihnachten machen. Da ich dringend Erholung brauche, wird es in diesem Zeitraum auch keine Neuveröffentlichungen auf HdS geben. Im Juli machen wir dann noch ein paar Wochen Programm, bevor unser Magazin nach fast 20 Jahren vom Netz geht. Ein trauriges Ereignis, auch für uns „Macher“. Im Sommer 2024 wird vermutlich auch der Trägerverein Initiative für eine humane Welt (IHW) aufgelöst werden. Dazu hat unser Kassenwart Volker Töbel in seinem Text etwas geschrieben. Informationshungrige lesen in dieser Zeit am besten Manova und andere gute politische Magazine. Bis dann! Wir hören voneinander. Roland Rottenfußer
Liebe Leserinnen und Leser von Hinter den Schlagzeilen, unser Magazin wird zwischen Mitte und Ende Juli seinen „Betrieb“ einstellen. Die Begründung hierfür steht in meinem Artikel, den ich unten noch mal angehängt habe. Von morgen, 15.06., bis Sonntag, 30.06., werde ich meinen ersten Urlaub seit Weihnachten machen. Da ich dringend Erholung brauche, wird es in diesem Zeitraum auch keine Neuveröffentlichungen auf HdS geben. Im Juli machen wir dann noch ein paar Wochen Programm, bevor unser Magazin nach fast 20 Jahren vom Netz geht. Ein trauriges Ereignis, auch für uns „Macher“. Im Sommer 2024 wird vermutlich auch der Trägerverein Initiative für eine humane Welt (IHW) aufgelöst werden. Dazu hat unser Kassenwart Volker Töbel in seinem Text etwas geschrieben. Informationshungrige lesen in dieser Zeit am besten Manova und andere gute politische Magazine. Bis dann! Wir hören voneinander. Roland Rottenfußer 
 Der berühmte „deutsche Geist“ findet nicht die Mitte zwischen Großmannssucht und Selbstekel. Oft schlagen Weltbeglückungsabsichten in ihr Gegenteil um. „Salopp gesagt: Wir mögen uns nicht.“ So beschreibt die Sachbuchautorin Gabriele Baring die Einstellung der Deutschen zu sich selbst. Warum eigentlich nicht? Schuldgefühle, die wegen der deutschen Verbrechen des „Dritten Reiches“ nachhaltig unsere Kollektivseele überschatten, sind sicher eine naheliegende Antwort. Dies führt zu Selbstsabotage und permanentem grüblerischem Hadern mit uns selbst. Wieder manifestiert sich, wie so oft in der Geschichte, die bipolare Störung der Deutschen. Einerseits erleben wir derzeit eine mit ökologischen und woken Elementen angereicherte Variante des Slogans, am deutschen Wesen solle „die Welt genesen“; andererseits ist das Land infolge eines sich ausbreitenden Desinteresses an eigener Kultur dabei, sich in europäischen Strukturen aufzulösen und den Zwängen der Globalisierung zu erliegen. Damit aber verlieren wir uns selbst, ohne dass die von uns in eifriger Fremdenfreundlichkeit verehrten anderen Länder etwas dabei gewinnen würden. Viel Unheil, das in der Geschichte von Deutschland ausging, rührte von einem pathetisch-aufgeblähten „Gutseinwollen“ her, der Idee einer geistig-moralischen Vormachtstellung des Landes im „Herzen Europas“, seit dem Zweiten Weltkrieg jedoch vermengt mit Minderwertigkeitsgefühlen. „Ich wusste mit Deutschland noch nie etwas anzufangen“, sagte
Der berühmte „deutsche Geist“ findet nicht die Mitte zwischen Großmannssucht und Selbstekel. Oft schlagen Weltbeglückungsabsichten in ihr Gegenteil um. „Salopp gesagt: Wir mögen uns nicht.“ So beschreibt die Sachbuchautorin Gabriele Baring die Einstellung der Deutschen zu sich selbst. Warum eigentlich nicht? Schuldgefühle, die wegen der deutschen Verbrechen des „Dritten Reiches“ nachhaltig unsere Kollektivseele überschatten, sind sicher eine naheliegende Antwort. Dies führt zu Selbstsabotage und permanentem grüblerischem Hadern mit uns selbst. Wieder manifestiert sich, wie so oft in der Geschichte, die bipolare Störung der Deutschen. Einerseits erleben wir derzeit eine mit ökologischen und woken Elementen angereicherte Variante des Slogans, am deutschen Wesen solle „die Welt genesen“; andererseits ist das Land infolge eines sich ausbreitenden Desinteresses an eigener Kultur dabei, sich in europäischen Strukturen aufzulösen und den Zwängen der Globalisierung zu erliegen. Damit aber verlieren wir uns selbst, ohne dass die von uns in eifriger Fremdenfreundlichkeit verehrten anderen Länder etwas dabei gewinnen würden. Viel Unheil, das in der Geschichte von Deutschland ausging, rührte von einem pathetisch-aufgeblähten „Gutseinwollen“ her, der Idee einer geistig-moralischen Vormachtstellung des Landes im „Herzen Europas“, seit dem Zweiten Weltkrieg jedoch vermengt mit Minderwertigkeitsgefühlen. „Ich wusste mit Deutschland noch nie etwas anzufangen“, sagte  Der herrschende Materialismus betrachtet den Menschen und die Welt als sinn- und leblose Apparaturen. Nun soll uns das letzte Stück Lebendigkeit ausgetrieben werden. „Leben muss erst Leben geben“, sagte Goethe. Aus toter Materie kann nicht plötzlich etwas Lebendiges entstehen. Bewusstsein kann nur aus einem größeren Bewusstseinsraum hervorgehen. Nur etwas oder jemand Seelenhaftes kann Seele „einhauchen“. Solche Gedanken sind nicht unbedingt „esoterisch“, im Grunde sind sie logisch nachvollziehbar. Wissenschaftlich ist das Geheimnis des Lebens ebenso wie das der Seele keineswegs in befriedigender Weise erklärt worden. Noch immer aber wird der rationalistische Mythos gepflegt, unser Körper sei aus einem toten Universum durch zufällige Kombination von Molekülen hervorgegangen. Aus ihm hätte sich dann — ebenso zufällig — aufgrund wachsender Komplexität irgendwie Bewusstsein gebildet. Zu einem toten Kosmos aber passen nur völlig leblose Daseinsformen. Die transhumanistische Philosophie versucht nun paradoxerweise, Lebewesen von ihrer Nichtlebendigkeit zu überzeugen. Dies gelingt ihr mit oft haarsträubenden Gedankenkonstruktionen, während uns die Politik einer Gehorsamsdressur unterwirft und die Wirtschaft planmäßig unsere Abhängigkeit von Apparaten verstärkt. Ein streng materialistisches Weltbild aber war von Anfang an eine Lüge. Wer so niedrig über uns denkt, will uns erniedrigen, um uns besser steuern zu können. Wir sollten anfangen, uns dagegen zu wehren und unsere Lebendigkeit in vollem Umfang in Anspruch nehmen. Roland Rottenfußer
Der herrschende Materialismus betrachtet den Menschen und die Welt als sinn- und leblose Apparaturen. Nun soll uns das letzte Stück Lebendigkeit ausgetrieben werden. „Leben muss erst Leben geben“, sagte Goethe. Aus toter Materie kann nicht plötzlich etwas Lebendiges entstehen. Bewusstsein kann nur aus einem größeren Bewusstseinsraum hervorgehen. Nur etwas oder jemand Seelenhaftes kann Seele „einhauchen“. Solche Gedanken sind nicht unbedingt „esoterisch“, im Grunde sind sie logisch nachvollziehbar. Wissenschaftlich ist das Geheimnis des Lebens ebenso wie das der Seele keineswegs in befriedigender Weise erklärt worden. Noch immer aber wird der rationalistische Mythos gepflegt, unser Körper sei aus einem toten Universum durch zufällige Kombination von Molekülen hervorgegangen. Aus ihm hätte sich dann — ebenso zufällig — aufgrund wachsender Komplexität irgendwie Bewusstsein gebildet. Zu einem toten Kosmos aber passen nur völlig leblose Daseinsformen. Die transhumanistische Philosophie versucht nun paradoxerweise, Lebewesen von ihrer Nichtlebendigkeit zu überzeugen. Dies gelingt ihr mit oft haarsträubenden Gedankenkonstruktionen, während uns die Politik einer Gehorsamsdressur unterwirft und die Wirtschaft planmäßig unsere Abhängigkeit von Apparaten verstärkt. Ein streng materialistisches Weltbild aber war von Anfang an eine Lüge. Wer so niedrig über uns denkt, will uns erniedrigen, um uns besser steuern zu können. Wir sollten anfangen, uns dagegen zu wehren und unsere Lebendigkeit in vollem Umfang in Anspruch nehmen. Roland Rottenfußer  Nach der Aufdeckung der „RKI-Files“ durch das Magazin Multipolar versuchen sich die Täter der Coronapolitik verzweifelt aus der Affäre zu ziehen. Ein wirklich freier Journalismus wirkt. Es gibt nur mittlerweile zu wenig davon. Umso mehr löst es in der Öffentlichkeit Verblüffung aus, wenn tatsächlich einmal ein Medium die Politik der Regierung und anderer mächtiger öffentlicher Institutionen kritisiert und ans Licht holt, was diese gern unter dem Deckel gehalten hätten. Dergleichen war man von Journalisten eigentlich nicht mehr gewohnt, obwohl genau darin ja ihre ureigenste Aufgabe besteht. Mit der Veröffentlichung der RKI-Protokolle durch das Magazin Multipolar ist der oft so genannte „alternative Journalismus“ stärker als je zuvor in die Sichtbarkeit getreten und zwang den Mainstream, auf ihn zu reagieren. Zugleich offenbarte der Vorgang das Versagen der Leitmedien, wie mittlerweile sogar
Nach der Aufdeckung der „RKI-Files“ durch das Magazin Multipolar versuchen sich die Täter der Coronapolitik verzweifelt aus der Affäre zu ziehen. Ein wirklich freier Journalismus wirkt. Es gibt nur mittlerweile zu wenig davon. Umso mehr löst es in der Öffentlichkeit Verblüffung aus, wenn tatsächlich einmal ein Medium die Politik der Regierung und anderer mächtiger öffentlicher Institutionen kritisiert und ans Licht holt, was diese gern unter dem Deckel gehalten hätten. Dergleichen war man von Journalisten eigentlich nicht mehr gewohnt, obwohl genau darin ja ihre ureigenste Aufgabe besteht. Mit der Veröffentlichung der RKI-Protokolle durch das Magazin Multipolar ist der oft so genannte „alternative Journalismus“ stärker als je zuvor in die Sichtbarkeit getreten und zwang den Mainstream, auf ihn zu reagieren. Zugleich offenbarte der Vorgang das Versagen der Leitmedien, wie mittlerweile sogar  In vielen Kulturen kennt man das Meer als Symbol des Todes und der mystischen Einheit. Man kann ein Glas voll Meerwasser unter dem Mikroskop untersuchen und wird dort unzählige aufgelöste Mineralien wie auch Kleinstlebewesen finden. Kein Zweifel: Der Mensch hat das Meer „im Griff“, er glaubt, es verstanden zu haben — wie alles andere auch. Damit ist aber der Zauber noch nicht erklärt, den die weite spiegelnde Fläche mit den darunter liegenden undurchsichtigen Tiefen seit jeher auf Menschen ausgeübt hat. Das Meer wurde — wie Wasser überhaupt — zum Gegenstand unzähliger Mythen und symbolischer Deutungen in der Kunst wie auch in spirituellen Lehren. Kein Wunder, denn je nach Betrachtungsweise verbinden wir mit dem Meer Leben oder auch Tod. Es ist Ziel der großen Reise des Wassers durch die Welt oder auch Ausgangspunkt einer neuen. Dieser Artikel will Wasser einmal nicht als Getränk, Handelsware oder Aufenthaltsort von Fischen beschreiben, sondern seiner Wirkung auf den menschlichen Geist nachspüren. Er versteht sich nicht als Glaubensbekenntnis, das sich anderen aufdrängt, eher als Einladung zu einem Streifzug durch Kultur- und Religionsgeschichte. Ein Text zum #Wasserspezial. Roland Rottenfußer
In vielen Kulturen kennt man das Meer als Symbol des Todes und der mystischen Einheit. Man kann ein Glas voll Meerwasser unter dem Mikroskop untersuchen und wird dort unzählige aufgelöste Mineralien wie auch Kleinstlebewesen finden. Kein Zweifel: Der Mensch hat das Meer „im Griff“, er glaubt, es verstanden zu haben — wie alles andere auch. Damit ist aber der Zauber noch nicht erklärt, den die weite spiegelnde Fläche mit den darunter liegenden undurchsichtigen Tiefen seit jeher auf Menschen ausgeübt hat. Das Meer wurde — wie Wasser überhaupt — zum Gegenstand unzähliger Mythen und symbolischer Deutungen in der Kunst wie auch in spirituellen Lehren. Kein Wunder, denn je nach Betrachtungsweise verbinden wir mit dem Meer Leben oder auch Tod. Es ist Ziel der großen Reise des Wassers durch die Welt oder auch Ausgangspunkt einer neuen. Dieser Artikel will Wasser einmal nicht als Getränk, Handelsware oder Aufenthaltsort von Fischen beschreiben, sondern seiner Wirkung auf den menschlichen Geist nachspüren. Er versteht sich nicht als Glaubensbekenntnis, das sich anderen aufdrängt, eher als Einladung zu einem Streifzug durch Kultur- und Religionsgeschichte. Ein Text zum #Wasserspezial. Roland Rottenfußer Der Zeitgeist will uns die Lebendigkeit austreiben und sieht selbst unsere Existenz als Problem. Es könnte so schön auf dieser Erde sein, wenn da nicht ein Störfaktor wäre: Lebewesen. Sie verbreiten Schmutz, verbrauchen Platz und Ressourcen, verstören durch Irrationalität und neigen dazu, das ganze Elend zu potenzieren, indem sie sich vermehren. Selbst wenn man in Rechnung stellt, dass einige von ihnen ganz brauchbar sind, so gilt das ganz gewiss nicht für alle. Unter allen Lebensformen ist der Mensch die problematischste. Er ist nicht nur für andere eine Plage — infolge seiner außergewöhnlichen Vulnerabilität leidet er fast immer an sich selbst und anderen. Lohnt sich die Existenz eigentlich? Man möchte fast Mephisto recht geben mit seinem Spruch „Drum besser wär’s, dass nichts entstünde“. Da das Lebendige aber nun mal schon da ist, wollen viele es uns madig machen, wollen es aushöhlen und immer lebloser machen. So mancher will erreichen, dass sich Leben nicht fortpflanzt, oder tut sein Bestes, damit es ganz endet. Das Leben ist in letzter Zeit etwas aus der Mode gekommen. Intelligenz funktioniert auch ohne Bewusstsein, wie uns die neuen KI-Modelle eindrucksvoll vor Augen geführt haben. Schon gar nicht braucht Intelligenz eine organische Hardware als Träger. Der Beitrag sammelt die existierenden Einwände gegen das Leben. Zumindest sollten sich die Leser — wie der Autor selbst — nach der Lektüre etwas für ihr Dasein schämen. Roland Rottenfußer
Der Zeitgeist will uns die Lebendigkeit austreiben und sieht selbst unsere Existenz als Problem. Es könnte so schön auf dieser Erde sein, wenn da nicht ein Störfaktor wäre: Lebewesen. Sie verbreiten Schmutz, verbrauchen Platz und Ressourcen, verstören durch Irrationalität und neigen dazu, das ganze Elend zu potenzieren, indem sie sich vermehren. Selbst wenn man in Rechnung stellt, dass einige von ihnen ganz brauchbar sind, so gilt das ganz gewiss nicht für alle. Unter allen Lebensformen ist der Mensch die problematischste. Er ist nicht nur für andere eine Plage — infolge seiner außergewöhnlichen Vulnerabilität leidet er fast immer an sich selbst und anderen. Lohnt sich die Existenz eigentlich? Man möchte fast Mephisto recht geben mit seinem Spruch „Drum besser wär’s, dass nichts entstünde“. Da das Lebendige aber nun mal schon da ist, wollen viele es uns madig machen, wollen es aushöhlen und immer lebloser machen. So mancher will erreichen, dass sich Leben nicht fortpflanzt, oder tut sein Bestes, damit es ganz endet. Das Leben ist in letzter Zeit etwas aus der Mode gekommen. Intelligenz funktioniert auch ohne Bewusstsein, wie uns die neuen KI-Modelle eindrucksvoll vor Augen geführt haben. Schon gar nicht braucht Intelligenz eine organische Hardware als Träger. Der Beitrag sammelt die existierenden Einwände gegen das Leben. Zumindest sollten sich die Leser — wie der Autor selbst — nach der Lektüre etwas für ihr Dasein schämen. Roland Rottenfußer  Wenn uns das Leben auf dieser Erde lieb ist, müssen wir der gefährlichen Tendenz zur Selbstzerstörung widerstehen. „Jeder will leben und Leben erhalten“. Diese Auffassung ist verbreitet, dennoch ist sie naiv. Immer mehr Menschen, Kulturen, ja die ganze Menschheit zeigen einen Hang zur Selbstzerstörung. Individuell beobachten wir wachsende Selbstmordneigung, zumindest Lebensüberdruss, eine müde Unlust, sich dem Leben zu stellen und es zu gestalten. Freiwillige Kinderlosigkeit, Unfruchtbarkeit, aber auch die systematische, zumindest fahrlässige Gefährdung und Traumatisierung von Kindern breiten sich aus, als wollten Teile der Gesellschaft die Zukunft, die von unserem Nachwuchs repräsentiert wird, gar nicht mehr haben. Die westliche Kultur – und hier vor allem Deutschland – gefällt sich in resignierter Selbstaufgabe, gibt zivilisatorische Errungenschaften willig preis. Die ökologische Katastrophe scheint die Existenzberechtigung des Menschen als solchem obsolet zu machen. Unter dem Dauerbeschuss kränkender Pauschalbeschimpfungen scheinen viele zumindest unbewusst bereit, den eigenen Untergang als reinigenden Akt zu begrüßen. Todestrieb und Todessehnsucht sind aus der Geschichte und Literatur bekannte Seelenregungen. Die Psychotherapie hakte dergleichen als bedauerliche, aber prinzipiell heilbare Einzelfälle ab. Als kollektives Phänomen allerdings wird der Flirt mit der Selbstauslöschung zu einer Gefahr, die alles Leben auf dem Planeten bedroht. Roland Rottenfußer
Wenn uns das Leben auf dieser Erde lieb ist, müssen wir der gefährlichen Tendenz zur Selbstzerstörung widerstehen. „Jeder will leben und Leben erhalten“. Diese Auffassung ist verbreitet, dennoch ist sie naiv. Immer mehr Menschen, Kulturen, ja die ganze Menschheit zeigen einen Hang zur Selbstzerstörung. Individuell beobachten wir wachsende Selbstmordneigung, zumindest Lebensüberdruss, eine müde Unlust, sich dem Leben zu stellen und es zu gestalten. Freiwillige Kinderlosigkeit, Unfruchtbarkeit, aber auch die systematische, zumindest fahrlässige Gefährdung und Traumatisierung von Kindern breiten sich aus, als wollten Teile der Gesellschaft die Zukunft, die von unserem Nachwuchs repräsentiert wird, gar nicht mehr haben. Die westliche Kultur – und hier vor allem Deutschland – gefällt sich in resignierter Selbstaufgabe, gibt zivilisatorische Errungenschaften willig preis. Die ökologische Katastrophe scheint die Existenzberechtigung des Menschen als solchem obsolet zu machen. Unter dem Dauerbeschuss kränkender Pauschalbeschimpfungen scheinen viele zumindest unbewusst bereit, den eigenen Untergang als reinigenden Akt zu begrüßen. Todestrieb und Todessehnsucht sind aus der Geschichte und Literatur bekannte Seelenregungen. Die Psychotherapie hakte dergleichen als bedauerliche, aber prinzipiell heilbare Einzelfälle ab. Als kollektives Phänomen allerdings wird der Flirt mit der Selbstauslöschung zu einer Gefahr, die alles Leben auf dem Planeten bedroht. Roland Rottenfußer  Vielleicht sind uns Außerirdische näher, als wir bisher geglaubt hatten. Dass dies nicht allgemein bekannt ist, kann daran liegen, dass sie von Regierenden als Machtkonkurrenz gefürchtet werden. Außerirdische. Wir kennen sie in vielerlei Gestalt aus Science-Fiction-Serien. Nicht wenige davon nahmen Anleihen bei den Darstellungen von „Kontaktlern“ und Wissenschaftlern. Einige glauben, Raumschiffe und unerklärliche Lichterscheinungen gesehen zu haben. Andere berichten über Entführungen durch Aliens. Wieder andere behaupten, die Stimme kosmischer Wesen in ihrem Kopf vernommen zu haben. Derartigen Berichten zu misstrauen oder sie zu ironisieren liegt nahe. Schließlich gibt es UFO-Sichtungen spätestens seit den 40er-Jahren des 20. Jahrhunderts. Einige wollen die Besucher aus dem All schon in schriftlichen Aufzeichnungen und Bauwerken der Antike oder in Göttersagen aufgespürt haben. Bis jetzt konnten sie sich allerdings nicht dazu aufraffen, der verirrten Menschheit zu helfen. Ebenso wenig haben sie uns bis jetzt versklavt oder ausgelöscht. Es mag daran liegen, dass Außerirdische gar nicht existieren — eine Frage, die dieser Artikel naturgemäß nicht endgültig zu lösen vermag. Das Besondere am Geschehen seit 2023 ist jedoch, dass Regierungsstellen in den USA erstmals offiziell zugaben, über UFOs zu forschen. Auch sollen unidentifizierte Flugobjekte — ob sie nun von Aliens stammen oder irdischer Herkunft sind — vom Himmel geholt worden sein. Der Journalist Robert Fleischer hat in seinem Buch „Sie sind hier!“ Geschichten und Forschungsergebnisse rund um UFOs gesammelt. Er gelangte zu aufregenden Schlussfolgerungen darüber, wer „sie“ sein könnten und wie sie die enormen Entfernungen im Weltraum überbrücken haben könnten. Zugleich enthüllt er eine konzertierte Vertuschungsaktion durch die Sicherheitsapparate der Staaten und die von ihnen kontrollierten Medien — ein Vorgang, der uns im politischen Kontext durchaus vertraut vorkommt. Kein Wunder: Falls Außerirdische unter uns sind, würde dies das innerirdische Machtgefüge mächtig durcheinanderwirbeln. Roland Rottenfußer
Vielleicht sind uns Außerirdische näher, als wir bisher geglaubt hatten. Dass dies nicht allgemein bekannt ist, kann daran liegen, dass sie von Regierenden als Machtkonkurrenz gefürchtet werden. Außerirdische. Wir kennen sie in vielerlei Gestalt aus Science-Fiction-Serien. Nicht wenige davon nahmen Anleihen bei den Darstellungen von „Kontaktlern“ und Wissenschaftlern. Einige glauben, Raumschiffe und unerklärliche Lichterscheinungen gesehen zu haben. Andere berichten über Entführungen durch Aliens. Wieder andere behaupten, die Stimme kosmischer Wesen in ihrem Kopf vernommen zu haben. Derartigen Berichten zu misstrauen oder sie zu ironisieren liegt nahe. Schließlich gibt es UFO-Sichtungen spätestens seit den 40er-Jahren des 20. Jahrhunderts. Einige wollen die Besucher aus dem All schon in schriftlichen Aufzeichnungen und Bauwerken der Antike oder in Göttersagen aufgespürt haben. Bis jetzt konnten sie sich allerdings nicht dazu aufraffen, der verirrten Menschheit zu helfen. Ebenso wenig haben sie uns bis jetzt versklavt oder ausgelöscht. Es mag daran liegen, dass Außerirdische gar nicht existieren — eine Frage, die dieser Artikel naturgemäß nicht endgültig zu lösen vermag. Das Besondere am Geschehen seit 2023 ist jedoch, dass Regierungsstellen in den USA erstmals offiziell zugaben, über UFOs zu forschen. Auch sollen unidentifizierte Flugobjekte — ob sie nun von Aliens stammen oder irdischer Herkunft sind — vom Himmel geholt worden sein. Der Journalist Robert Fleischer hat in seinem Buch „Sie sind hier!“ Geschichten und Forschungsergebnisse rund um UFOs gesammelt. Er gelangte zu aufregenden Schlussfolgerungen darüber, wer „sie“ sein könnten und wie sie die enormen Entfernungen im Weltraum überbrücken haben könnten. Zugleich enthüllt er eine konzertierte Vertuschungsaktion durch die Sicherheitsapparate der Staaten und die von ihnen kontrollierten Medien — ein Vorgang, der uns im politischen Kontext durchaus vertraut vorkommt. Kein Wunder: Falls Außerirdische unter uns sind, würde dies das innerirdische Machtgefüge mächtig durcheinanderwirbeln. Roland Rottenfußer