Komplizen statt Kritiker
 Wer sich die Frage stellt, warum Journalisten größtenteils so angepasst sind, muss sich mit ihren Herkunftsmilieus und den Arbeitsbedingungen auseinandersetzen. Exklusivauszug aus „Cancel Culture“. Man beißt nicht in die Hand, die einen füttert. Diese Aussage trifft auf den zeitgenössischen eingebetteten Journalismus gleich in zweierlei Hinsicht zu. Zum einen muss man sich ein Journalismusstudium und unbezahlte Praktika leisten können, wodurch Söhne und Töchter aus wohlhabenden Milieus privilegiert sind. In Kreisen von „Stützen der Gesellschaft“ stellt man den Staat aber meist nicht infrage und ist mit dem herrschenden Gesellschaftssystem im Reinen. Der arm oder prekär lebende Mitbürger ist für den Journalisten dieses Typs in der Regel ein unbekanntes Wesen. Weiter spielt es natürlich eine Rolle, dass Journalisten der „unteren Ränge“ meistens schlecht bezahlt in Abhängigkeitsverhältnissen gehalten werden, sodass nur wenige ein Aufmucken gegenüber der Führungsetage wagen. Der Kommunikationswissenschaftler und Journalismus-Dozent Professor Michael Meyen ist bestens qualifiziert, die Medienszene einer kritischen Betrachtung zu unterziehen. Michael Meyen
Wer sich die Frage stellt, warum Journalisten größtenteils so angepasst sind, muss sich mit ihren Herkunftsmilieus und den Arbeitsbedingungen auseinandersetzen. Exklusivauszug aus „Cancel Culture“. Man beißt nicht in die Hand, die einen füttert. Diese Aussage trifft auf den zeitgenössischen eingebetteten Journalismus gleich in zweierlei Hinsicht zu. Zum einen muss man sich ein Journalismusstudium und unbezahlte Praktika leisten können, wodurch Söhne und Töchter aus wohlhabenden Milieus privilegiert sind. In Kreisen von „Stützen der Gesellschaft“ stellt man den Staat aber meist nicht infrage und ist mit dem herrschenden Gesellschaftssystem im Reinen. Der arm oder prekär lebende Mitbürger ist für den Journalisten dieses Typs in der Regel ein unbekanntes Wesen. Weiter spielt es natürlich eine Rolle, dass Journalisten der „unteren Ränge“ meistens schlecht bezahlt in Abhängigkeitsverhältnissen gehalten werden, sodass nur wenige ein Aufmucken gegenüber der Führungsetage wagen. Der Kommunikationswissenschaftler und Journalismus-Dozent Professor Michael Meyen ist bestens qualifiziert, die Medienszene einer kritischen Betrachtung zu unterziehen. Michael Meyen
In den Redaktionen stoßen die Botschaften des politischen Apparats aus zwei Gründen auf wenig Gegenwehr. Zum einen, das sei hier wiederholt, haben die wichtigsten Medienhäuser in Deutschland Konzerngröße und sind so selbst Teil der „Koalition zwischen den Unternehmen und dem Staat“, die bei Sheldon Wolin den „umgekehrten Totalitarismus“ ausmacht (1).
Die deutsche Presselandschaft ist von Monopolen und Konzentration geprägt sowie von einigen wenigen Verlagen — oft in Familienbesitz —, die nicht nur alle anderen Kanäle bespielen und auch sonst über das Kerngeschäft hinauswachsen (2), sondern ihre redaktionellen Dienste zum Teil auch an die „Konkurrenz“ verkaufen wie das Redaktionsnetzwerk Deutschland von Madsack, das mehr als 60 Regionalblätter in sieben Bundesländern beliefert (3). Der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist hier kein Gegenargument. Mit einem Beitragsaufkommen von knapp neun Milliarden Euro im Jahr gehören ARD und ZDF zu den größten Medienunternehmen der Welt (4) — Konzerne, die handeln müssen wie Konzerne und außerdem in nahezu jeder Hinsicht eng mit Politik und Staat verknüpft sind (5).
Zum anderen ist der Journalismus in Deutschland ein sozial homogenes Feld, das vom „Habitus der Mittelschicht“ dominiert wird — „auf Anpassung ausgerichtet“, programmiert auf „die Akzeptanz der Herrschaftsverhältnisse“ (6) und durch Herkunft, Ausbildungswege und Lebenssituation eng mit den Entscheidern in Staat, Parteien und Wirtschaft verbandelt.
Man muss es sich heute leisten können, Tochter oder Sohn in diesen Beruf zu schicken. Der Weg in eine Position, von der man halbwegs leben kann, führt über nicht oder schlecht bezahlte Hospitanzen und Praktika und erfordert in der Regel einen Hochschulabschluss und oft ein Volontariat sowie Jahre der Ungewissheit als Freiberufler.
Auch ohne Gebühren ist ein Studium teuer, vor allem dort, wo die großen Medienhäuser sind. Berlin, München, Frankfurt am Main, Hamburg, Köln. An der Deutschen Journalistenschule, wo die Elite des Berufs ausgebildet wird, muss man für einen Master zwei Jahre de facto komplett auf Nebenjobs verzichten — es wird Präsenz in jedem Sinn des Wortes verlangt — und trotzdem irgendwie leben. „Ein Wohnheim“, hat mir Henriette Löwisch gesagt, Leiterin der Schule, als ich sie 2019 nach ihren Wünschen gefragt habe. Und: mehr Vielfalt in den Klassen. Nach Ostdeutschen zum Beispiel muss man dort suchen. München können und wollen nicht alle Eltern ihren Kindern spendieren. „Ostdeutsch“ steht hier als Chiffre für die Vermögenslage und für Milieus, die eher von proletarischen Werten geprägt sind. Diese Milieus haben mit dem Schlüssel zu den Redaktionen auch den Zugang zur Leitmedienöffentlichkeit verloren und damit zu den Parteien. Was keine Nachricht wird, das existiert für Politiker nicht.
Mittelschichtkinder mit Unizeugnis, die in angesagten Großstadtbezirken leben — und damit gar nicht so selten über ihre Verhältnisse — und die schon qua Herkunft oft wenig Kontakte und Erfahrungen im ländlichen Raum und in Arbeitervierteln haben: Dieses Sozialprofil prägt nicht nur den Blick auf die Wirklichkeit, sondern auch den persönlichen Umgang.
Politik, Wirtschaft und Kultur rekrutieren ihre Entscheider in den gleichen Milieus. Aus der Ähnlichkeit von sozialer Position und Habitus wird im Alltag nicht selten echte Nähe. Kontakt — Pressekonferenzen, Empfänge, Reisen — schafft Sympathie und damit oft auch mindestens Verständnis (7). Der Leipziger Medienforscher Uwe Krüger hat für diese Wertegemeinschaft die Formel „Verantwortungsverschwörung“ geprägt (8): Journalisten wissen, was gut ist und was schlecht — so ziemlich das Gleiche, was ihre Alter Egos in anderen Bereichen gut oder schlecht finden —, und glauben, dass sie Einfluss auf die Menschen haben. Also wird die Wirklichkeit „um die Teile“ reduziert, „die nicht zur Haltung passen“, und das betont, was dem gewünschten Ziel zu helfen scheint (9) — manchmal mithilfe von Informationen, Anstößen und Material aus dem Propagandaapparat und manchmal ohne.
Der Siegeszug von Internet und Digitalplattformen — bei mir ein Synonym für den Begriff „soziale Medien“, der vortäuscht, es gehe dort um uns, unsere Bedürfnisse, unsere Liebsten — hat den Journalistenberuf umgekrempelt und dort den Boden für den Einzug der Cancel Culture bereitet. Der ökonomische Hintergrund in Kurzform: sinkende Auflagen, schon dadurch weniger Werbeeinnahmen, steigende Preise bei Papier, Energie, Vertrieb und dazu eine Konkurrenz, die Aufmerksamkeit bindet und jedem Verkäufer verspricht, den Kunden ohne Streuverlust genau dann anzusprechen, wenn er zum Geldausgeben bereit ist.
Die offensichtlichste Folge: Stellenabbau. In den Lokalredaktionen ist die Zahl der Redakteure zwischen 2010 und 2020 von 13.573 auf 11.288 gesunken (10). Geblieben sind die Seiten, die genau wie früher gefüllt und heute außerdem noch auf allen möglichen Kanälen gepostet werden müssen. Aus dem rasenden Reporter ist deshalb ein Stubenhocker geworden, der auf dem Bildschirm nach dem Leben sucht. Patrik Baab, ein Journalist von altem Schrot und Korn, lange für den NDR in Kiel und ganz nah dran bei etlichen Kriegen (11), beklagt, dass seine Kollegen oft weder Zeit noch Geld für Recherchen haben und nicht mehr zu den Quellen gehen. Für viele sei inzwischen die Kantine „der direkteste Kontakt“ zur Wirklichkeit (12). Von hier ist es nicht mehr weit bis zu Claas Relotius, dem preisgekrönten Spiegel-Mann, der sich seine Reportagen ausdenken konnte, weil er wusste, worauf Redaktion und Establishment stehen (13). Patrik Baab:
„Offenbar ist schon klar, wie die Geschichte auszusehen hat, bevor die Vor-Ort-Recherche überhaupt beginnt“ (14).
Das führt zurück zur Ökonomie: Selbst viele Onlineabos und noch mehr Werbebanner reichen nicht, um im Netz das Gleiche zu verdienen wie früher. Die Medienhäuser haben ab den 2010er-Jahren Paywalls hochgezogen und gleichzeitig die schon immer löchrige Grenze zur Redaktion endgültig geöffnet. Neu im Jobprofil: die Vermarktung der eigenen Person und vor allem der eigenen Produkte. Eine neue Generation enterte die Redaktionen, billiger als die alten Hasen, vertraut mit der digitalen Umwelt und im Verbund mit Twitter in der Lage, das Kommando zu übernehmen (15).
Auf den Digitalplattformen geht, auch das sei wiederholt, nichts über Publikumsbindung und Emotionen. Damit ein Artikel geteilt wird und möglichst viral geht — die ultimative Währung —, braucht er einen Identitätsanker. Klare Kante.
Wer je einen Account auf Facebook oder Instagram hatte, kennt das: Es geht immer um mich, um die Gruppe, zu der ich gehören will, oder um die, die ich aus vollem Herzen ablehne. Eins oder null und nichts dazwischen. Hier ist die Wurzel für einen Journalismus, der sich an „Sprache und Symbolik“ aufhängt (16) und an irgendwelchen Zugehörigkeiten. Und: Hier treffen sich Medienunternehmer, die ihre Angestellten zur Markenpflege auffordern und damit zu Konsistenz, mit Redakteuren, die sich selbst verwirklichen und noch weiter aufsteigen wollen und deshalb zuerst fragen, wie die Sache wohl an der Spitze der Nahrungskette aussieht. Zur Klassenfrage wird das, wenn Stil, Themen und Identitätsangebot ausschließlich auf die gebildeten Wohlstandsmilieus zielen, aber als „truth, information, data“ verkauft werden (17).
Noch einmal anders gewendet und etwas zugespitzt:
Der Journalist von heute geht nicht mehr hinaus, um mit Menschen zu sprechen und sich überraschen zu lassen, sondern formuliert das um, was seine Kollegen auf anderen Portalen geschrieben haben, und weiß dabei schon vorher, wie sein Urteil ausfallen wird, weil er sich in seinem Digitalprofil längst festgelegt hat.
Wenn ich gestern Greta Thunberg und ihre Freitagsjünger gefeiert habe, kann ich morgen nicht auf Klimakleber losgehen, ohne die Gefolgschaft zu verschrecken und meinem Arbeitgeber so Reichweite zu nehmen. Die Medienunternehmen wollten schon immer über ein möglichst zahlungskräftiges Publikum die besten Werbekunden erreichen und haben dafür alles ausgeblendet, was die Reichen und Schönen nicht interessiert oder verschrecken könnte. Im Digitalzeitalter verstärkt sich dieser Trend.
Die Schaffnerin, der Busfahrer, der Koch, die Kellnerin: All diese Menschen können nicht den ganzen Tag online sein und dort ihre Themen oder ihre Sicht auf die Wirklichkeit pushen. Die Redakteure treffen so auch auf den Bildschirmen vor allem auf ihresgleichen, neigen so fast zwangsläufig dazu, virtuelle und reale Welt zu verwechseln, und sind dann oft genug bereit, alle zu verbeißen, die das anzweifeln, was an Deutung und Moral von „ganz oben“ kommt und über das Propagandaheer im Netz groß aufgeblasen wird.
Was an Widerstandsgeist wachsen könnte, wird von den Arbeitsbedingungen erstickt. Während sich Volkes Stimme über Intendantengehälter empört, über Moderationshonorare oder über Gewinne von Talkshowgrößen, werden einfache Reporter und Redakteure in Abhängigkeit gehalten und gar nicht so selten in prekären Verhältnissen.
Im öffentlich-rechtlichen Rundfunk arbeiten zwei Drittel der Programmmitarbeiter freiberuflich (18). Schichten und Aufträge werden zwar ordentlich bezahlt, aber erstens ist es nicht so einfach, damit auf einen Vollzeitjob zu kommen, und zweitens — wichtiger — bringt der Status ganz automatisch Unsicherheit mit sich: Stehe ich nächsten Monat wieder im Dienstplan? Was muss ich tun, damit die Redaktion meinen Beitrag abnimmt und mich wieder losschickt?
Auszubrechen ist schwer ohne Kündigungsschutz. Ein lebender Beweis für diese These war 2019 bei mir in einer Vorlesung: Volker Bräutigam, Jahrgang 1941, ein Lkw-Fahrer, der als Autodidakt 1975 Redakteur der Tagesschau wurde, bis heute anders denkt, schreibt und spricht „als Kinder aus einer bürgerlichen Akademikerfamilie“ und damals den eigenen Laden in einem Buch heftig attackierte (19). Bräutigam im Hörsaal:
„Zwei Auflagen und mehr als 25.000 Exemplare. Es gab riesigen Ärger. Das ging nur, weil ich fest angestellt war. Ich konnte mir das leisten, nach dem Motto: Die können mich eh nicht rauswerfen. So etwas wäre heute undenkbar. Man wäre erledigt“ (20).
In den kommerziellen Medienhäusern sieht es nicht besser aus. Der Deutsche Journalistenverband dokumentiert auf seiner Webseite die „Tarifflucht der Verlage“. Wer lange dabei ist, hält in aller Regel wenigstens sein Lohnniveau, muss aber oft länger arbeiten. Von den Neuen verhandelt jeder „für sich allein. Die jungen Kollegen sind angemeiert. Die werden einfach abgespeist“ (21).
43 Prozent der Journalisten schätzen ihre Arbeitssituation als „prekär“ ein und 58 Prozent als „eher unsicher“ (22). Die Anziehungskraft dieses Berufs hat deshalb in den letzten Jahren spürbar nachgelassen. Selbst die Deutsche Journalistenschule München, die früher jedes Jahr 1.000 Bewerbungen bekam, hat inzwischen Mühe, im Auswahlverfahren für die 45 Plätze so etwas wie echte Konkurrenz entstehen zu lassen.
Hier können Sie das Buch bestellen: Buchkomplizen
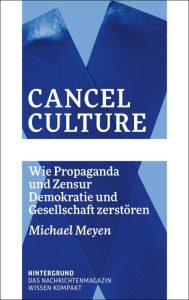
Quellen und Anmerkungen:
(1) Sheldon S. Wolin: Umgekehrter Totalitarismus, Frankfurt am Main 2022, Seite 221. — Siehe Kapitel 1.
(2) Herman Conen zeigt am Beispiel des Kölner Stadt-Anzeigers, dass Medienkonzerne wie DuMont längst „Machtkomplexe“ sind, „die realitätsbestimmend werden“, weil sie in jeden Bereich der Wirklichkeit hineinragen — von der Lokalpolitik und Expertenpools über Kulturveranstaltungen bis hin zum Ticketverkauf. Wer nicht mit dieser Zeitung geht, findet in Köln nicht statt. — Ausverkauf, Norderstedt 2019, Seite 93.
(3) Siehe Horst Röper: Zeitungsmarkt 2022, Media Perspektiven 2022, Seite 295 bis 318.
(4) Siehe Lutz Hachmeister, Christian Wagener, Till Wäscher: Wer beherrscht die Medien? Köln 2022.
(5) Siehe Alexis von Mirbach: Medienträume, Köln 2023, Seiten 128 bis 178, 250 bis 272.
(6) Marcus B. Klöckner: Sabotierte Wirklichkeit, Frankfurt am Main 2019, Seite 33.
(7) Siehe Michael Meyen: Die Propaganda-Matrix. Berlin 2021, Seiten 176 bis 198.
(8) Uwe Krüger: Mainstream, München 2016, Seite 105.
(9) Birk Meinhardt: Wie ich meine Zeitung verlor, Berlin 2020, Seite 87.
(10) Econ: Die Situation der lokalen Presse in Deutschland und ihre Herausforderungen im Zeitalter der Digitalisierung, Berlin 2022, Seite 24.
(11) Siehe Patrik Baab: Auf beiden Seiten der Front, Frankfurt am Main 2023.
(12) Patrik Baab: Recherchieren, Frankfurt am Main 2022, Seite 42.
(13) Siehe Juan Moreno: Tausend Zeilen Lüge, Berlin 2019.
(14) Patrik Baab: Recherchieren, Frankfurt am Main 2022, Seite 160.
(15) Siehe für die USA Batya Ungar-Sargon: Bad News, New York 2021.
(16) Sahra Wagenknecht: Die Selbstgerechten, Frankfurt am Main 2021, Seite 26.
(17) Batya Ungar-Sargon: Bad News, New York 2021, Seite 114.
(18) Stefan Fries: Versteckte Opfer des Spardrucks, Deutschlandfunk, 23. April 2018.
(19) Die Tagesschauer, Reinbek 1982.
(20) Alexis von Mirbach, Michael Meyen: Das Elend der Medien, Köln 2021, Seite 235.
(21) Regionalzeitungsredakteurin, Jahrgang 1968. Ebenda, Seite 110.
(22) Thomas Hanitzsch, Jana Rick: Prekarisierung im Journalismus, München 2021, Seite 2.

