Wer wird Milliardärin?
 Armut und Reichtum sind zwei Pole des gierigen Finanzsystems. Exklusivabdruck aus „Hunderttausend Milliarden zu viel“. Ein Kontrapunkt zur Armut ist der sehr leicht gewonnene Reichtum von ganz wenigen. Wer Armut bekämpfen will, sollte dies nicht isoliert versuchen. Erst wenn man die Verteilung des Geldes als Quelle des Ungleichgewichts erkennt und an diesem Punkt systematisch eingreift, kann man Armut und Superreichtum gleichzeitig bekämpfen und am Ende vielleicht abschaffen. Der Geldüberfluss im System ist aus Sicht der Armen schwer vorstellbar, aber ein entscheidender Grund für die Verarmung. Wie man aus dem vorhandenen Überfluss ein riesiges persönliches Vermögen auf seine Seite bringt, schildert der folgende Text an drei Beispielen: Mark Zuckerberg, Jeff Bezos und Elon Musk. Es handelt sich nicht um eine Anleitung, reich zu werden, sondern um ein unterhaltsames Kapitel aus dem Buch des Autors: „Hunderttausend Milliarden zu viel“. Rob Kenius
Armut und Reichtum sind zwei Pole des gierigen Finanzsystems. Exklusivabdruck aus „Hunderttausend Milliarden zu viel“. Ein Kontrapunkt zur Armut ist der sehr leicht gewonnene Reichtum von ganz wenigen. Wer Armut bekämpfen will, sollte dies nicht isoliert versuchen. Erst wenn man die Verteilung des Geldes als Quelle des Ungleichgewichts erkennt und an diesem Punkt systematisch eingreift, kann man Armut und Superreichtum gleichzeitig bekämpfen und am Ende vielleicht abschaffen. Der Geldüberfluss im System ist aus Sicht der Armen schwer vorstellbar, aber ein entscheidender Grund für die Verarmung. Wie man aus dem vorhandenen Überfluss ein riesiges persönliches Vermögen auf seine Seite bringt, schildert der folgende Text an drei Beispielen: Mark Zuckerberg, Jeff Bezos und Elon Musk. Es handelt sich nicht um eine Anleitung, reich zu werden, sondern um ein unterhaltsames Kapitel aus dem Buch des Autors: „Hunderttausend Milliarden zu viel“. Rob Kenius
Wer wird Milliardärin?
Vor 50 bis 60 Jahren waren die größten Stars erfolgreiche Musiker. Die populäre Musik erlebte eine seltene Blüte, wie schon zweihundert und mehr Jahre zuvor die Klassik. Man kennt und nennt sie heute noch: Bach, Beethoven, Mozart, Händel, Verdi … bis Rachmaninow, und dann kamen die Beatles, Rolling Stones, Beach Boys, Bob Dylan, Joan Baez, Pink Floyd, The Who und nicht zuletzt Chuck Berry und Jimi Hendrix. In Deutschland gab es Ton Steine Scherben mit Rio Reiser, die eine politische Botschaft verkündeten.
Obwohl die meisten Songs unpolitisch waren und an erster Stelle nur das neue Lebensgefühl der nach dem Krieg aufgewachsenen Generation ausdrückten (Make love, not war!), war die Musik der Soundtrack einer politischen Bewegung, die der sogenannten 68er. Das faktische Ergebnis dieser Bewegung war in den USA die Einstellung des Vietnamkriegs. Die Regierung konnte diesen unsinnigen Krieg nicht mehr weiterführen, weil eine Massenbewegung der Jugend ernsthaft und unermüdlich dagegen kämpfte.
Viele Historiker werden dieser Deutung widersprechen, weil sie nicht glauben, dass eine kulturelle Bewegung den Krieg stoppen kann. Aber sie hat ihn gestoppt. Etwas Vergleichbares wäre heute, in den 20er-Jahren des 21. Jahrhunderts, in unserem Kulturkreis nicht mehr denkbar. Von militärischen Kreisen der USA und der NATO aus haben die sogenannten Atlantiker ihren Einfluss auf alle großen Medien ausgedehnt und auch das Internet weitgehend unter Kontrolle gebracht.
Die Befürworter des aufgewärmten kalten Krieges sind Meinungsführer geworden, und sie haben erreicht, dass so etwas wie der erfolgreiche Protest gegen den Vietnamkrieg nicht noch einmal passiert und auch in nächster Zukunft nicht geschehen soll. Das öffentliche Bewusstsein ist unter Kontrolle der Strategen.
Gleichzeitig ist, selbst in der Jugendkultur, die Rolle, die Geld bei der Bewertung von Personen und Lebenszielen spielt, ganz in den Vordergrund gerückt. Die erfolgreichen Musiker in der großen Zeit der Rockmusik haben zwar Millionen verdient, doch das Geld spielte nicht die entscheidende Rolle in ihrem Bewusstsein. Mick Jagger hat einmal, als er darauf angesprochen wurde, dass er doch eine Menge Geld mit seiner Show verdient, nur gesagt: „Das Geld, das ich verdiene, gebe ich auch schnell wieder aus.“
Das klingt glaubhaft und ist im Sinne der Ökonomie eine positive Einstellung — Geld muss fließen. Fünfzig Jahre später sind die Rolling Stones immer noch unterwegs, sie nehmen auf einer Tournee ein paar Millionen ein und verpulvern das Geld irgendwie, ohne dass man eine riesige Ansammlung von Reichtum erkennen könnte, mal abgesehen von einem Haus in Ocho Rios, im paradiesischen Ambiente der Karibik, das Keith Richards gehört.
Ein ähnliches uninteressiertes Verhältnis zum Geldverdienen — und zu offiziellen Lorbeeren — hat auch Bob Dylan gezeigt. Er hat nicht einmal den Nobelpreis für Literatur abgeholt. Allein ein Auftritt in Stockholm, vielleicht im Maßanzug und mit Krawatte, hätte die Kassen ein paar Millionen Mal klingeln lassen.
Geld an sich ist nicht das Ziel und der Maßstab des Erfolgs dieser 68er-Generation. Natürlich gibt es Ausnahmen wie Richard Branson, der mit dem Musik-Label Virgin begann und diese Marke zu einer permanenten Geldmaschine entwickelt hat, bis sie ihn zum Milliardär machte, der sein Geld auf den Virgin Islands bunkert, von denen eine Insel ihm ganz gehören soll. Ex-Präsident Obama, der Friedensnobelpreisträger, war dort zu Gast und kann es bestätigen.
Das Verhältnis zwischen Erfolg und Geld hat sich sehr gewandelt. Die erfolgreichsten Leute, auch im Bewusstsein der Massen, sind jetzt Großgeldbesitzer. Leute wie Jeff Bezos, Mark Zuckerberg und Elon Musk. Sie alle sind vielfache Milliardäre. Und nicht vergessen: Zwischen Million und Milliarde besteht ein Faktor von tausend. Tausend Bob Dylans haben so viel Geld wie ein Elon Musk. Ein paar hundert Madonnas so viel wie ein Zuckerberg.
Es wird inzwischen nicht nur tausendmal so viel Geld verdient, das Geld hat auch im Bewusstsein der Medien und der Massen über die Jahrzehnte einen viel größeren Stellenwert bekommen, es steht als Wertmaßstab über allen anderen Werten.
Das ist paradox, ein Widerspruch zwischen Realität und Bewusstsein. Eine Sache, die, wie das Geld, immer mehr wird, kann nicht gleichzeitig immer noch wertvoller werden.
Die Coronakrise mit ihren rigorosen Maßnahmen hat diejenigen am meisten getroffen, die glaubten, mit Musik, Konzerten, Theater, Gastronomie, Veranstaltungen und Beliebtheit beim Publikum, kurz gesagt: als Kulturträger ein gutes Auskommen zu finden. Aber Kultur und direkte menschliche Kontakte sind out, Impfkampagnen, Gesundheitstests, Pharmazie und Staatskredite für Rüstung sind angesagt, und sie bringen das große Geld aus den Kassen der Allgemeinheit auf die Konten der Pharma-, Rüstungs- und Finanzindustrie.
Wenn es noch eine Jugendkultur gibt, dann sind die Vorreiter dieser Kultur die Influencerinnen. Diese Spitzenreiter der Jugendträume sind aber keine Kulturschaffenden. Sie setzen ihre Kreativität und Persönlichkeit dafür ein, Produktwerbung für modische Konsumartikel zu betreiben. Ihr Erfolg wird in Geld und in Klicks auf Videos gemessen, die man direkt in Geld umrechnen kann. Zehn Klicks bringen einen Cent oder so ähnlich. Einige Influencerinnen haben die Schwelle des Milliardenvermögens bereits erreicht.
Die größten Finanzerfolge zu Beginn des neuen Jahrtausends hatten die bereits erwähnten Jeff Bezos, Mark Zuckerberg und Elon Musk. Ihnen ist eine — unbewusste oder bewusste — Taktik, wie sie zu Superreichen geworden sind, gemeinsam: Sie sind nicht durch Umsätze und Firmengewinne Milliardäre geworden, wie das bisher üblich war, sondern erst durch den endgültigen Börsengang. Das ist strukturell ein großer Unterschied. Jeff Bezos, Mark Zuckerberg und Elon Musk haben ihre Milliarden nicht auf dem realen Markt der Wirtschaft verdient, sondern in der Finanzwelt, indem sie Anteile an ihren Firmen in Form riesiger Mengen an Aktien zu einem erstaunlichen Kurs verkauft haben.
Bei diesen Beispielen steht hinter den Firmen jeweils eine einzige, überschaubare Idee: Amazon, der weltgrößte Versandhandel, erst mit Büchern, dann mit allem, was man versenden kann, Facebook, die am meisten frequentierte Kontaktmaschine im Internet, und Tesla, das konsequente und bekannteste Elektroauto.
Die Haupteigentümer haben ihre Idee und die Expansion der Firmen zunächst durch das Geld von risikobereiten Kreditgebern vorangetrieben, nicht durch Gewinne. Sie fanden Großgeldbesitzer, die von der Idee Amazon, Facebook oder Tesla früh zu überzeugen waren, auch ohne durchschlagende Erfolge auf dem realen Markt.
Und ehe ein stabiler Gewinn erzielt wurde, sind sie mit viel Getöse an die Börse gegangen. Erst dabei sind die Milliarden an Dollars wolkenbruchartig vom Himmel gestürzt. Seitdem sind Bezos, Zuckerberg und Musk nicht mehr die vielversprechenden Kreditnehmer, sondern — mit ihrem eigenen Anteil an den Aktien — theoretische Multimilliardäre.
Das Neue an dieser Entwicklung ist, sie haben diesen Status mit Geld direkt aus der Finanzwelt erreicht, nicht mit Gewinnen ihrer Unternehmen in der realen Wirtschaft. Man kann es ganz einfach so formulieren: Nach dem Börsengang besitzen sie persönlich einen konkreten Anteil am globalen Geldüberfluss. Wer dieses Schema der Firmenentwicklung verfolgt, wird am schnellsten Milliardär oder auch Milliardärin.
Die Faustregel für den Erfolg ohne Ausgangsvermögen lautet: Mach deine Idee überall bekannt. Finde Risikokapital, das dich unterstützt, mach so viel Tamtam wie nur möglich. Achte nicht zu sehr auf Gewinn und Verlust. Expandiere schnell auf Basis von Krediten. Geld ist ganz oben sehr, sehr leicht zu bekommen, weil es in unbegrenzter Menge vorhanden ist.
Wenn du groß und bekannt genug bist, benötigst du nicht einmal eine positive Firmenbilanz, sondern nur Mut und die Unterstützung von Insidern in der Finanzwelt, um an die Börse zu gehen. Die Nachfrage nach lukrativen Aktien ist so riesengroß, dass die Welt bereit ist, mal schnell ein paar hundert Milliarden bei einem spektakulären Börsengang zu riskieren.
Das Schema ist zwar etwas kompliziert und verlangt viel Selbstvertrauen, aber nachdem es mehrmals erfolgreich praktiziert wurde, ist es für EDV-affine Schlaumeier doch zu überschauen und nachzumachen. Man glaubt jetzt, es genüge die Idee einer raffinierten Dienstleistung, die man möglichst mit einem Computerprogramm beziehungsweise einer App erledigen kann, und schon sind der Börsengang und die erste Milliarde in Sicht. Bis dahin muss das Risikokapital im dreistelligen Millionenbereich fließen.
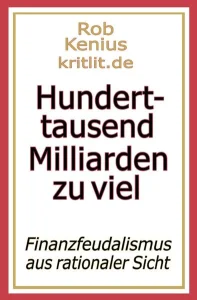
Hier können Sie das Buch bestellen: Hugendubel

