Liebhaber der Weisheit
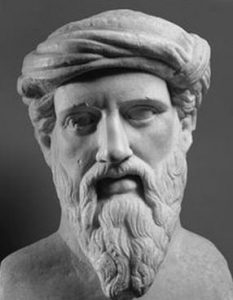
“AquadratplusBquadratgleichCquadrat”? Das auch, aber Pythagoras hatte noch mehr drauf.
Bildhauer wie Donatello und Michelangelo formten in der Renaissance schöne, nackte Körper nach dem Vorbild griechischer Meister wie Phidias. Goethe ließ seine Iphigenie „das Land der Griechen mit der Seele suchen“. In Gedichten und Theaterstücken, auf Gemälden ‒ bis weit ins 20. Jahrhundert hinein ‒ wimmelte es von Venussen und Danaes, Ödipussen und Antigones. Die Vorbildfunktion griechischer Kultur erstreckte sich buchstäblich von Botticelli bis Albert Speer. Heute meinen wir auf eine verstaubte bürgerliche Auffassung von „Bildung“, auf eingepauktes Wissen über die kulturellen Hervorbringungen einer sogenannten Hochkultur verzichten zu können. Wozu der alte Krempel? Leben geschieht hier und jetzt. Da wundert es nicht, dass auch Sokrates und Sophokles, Homer und Heraklit nicht gerade hoch im Kurs stehen.
Zeit des Erwachens
Trotzdem behaupte ich: Menschen, die bereits ein gewisses Interesse für Philosophie und Mystik ‒ z.B. in ihrer indischen Ausprägung ‒ entwickelt haben, können von griechischer Weisheit noch immer unendlich profitieren. Manches scheinbar Exotische rückt uns beim Studium der Griechen sehr nahe.
Das sechste Jahrhundert v. u. Z. (600-500 v. Chr.) kann in der Welt-Kulturgeschichte als Schwellenzeit bezeichnet werden. In dieser Ära schien an verschiedenen Orten des Globus der Geist zu explodieren und es fand ‒ zumindest in elitären Kreisen ‒ ein außergewöhnliches geistig-spirituelles Erwachen statt. Laotse lebte etwa 609-517 v. u. Z., Buddha 563-483, Pythagoras 580-500. Innerhalb des selben Zeitfensters wirkten vermutlich auch der jüdische Prophet Jeremias und der persische Religionsstifter Zarathustra. Die Geschichtsforschung nimmt an, dass diese Kulturen sich nicht oder fast nicht gegenseitig beeinflussten. Allerdings gibt es so etwas wie eine „unterirdische Strömung“ griechischer Philosophie, die auf noch ältere ägyptische Mysterienschulen zurückgeht. Der Philosophiehistoriker Hans Joachim Störig beschreibt diese „Unterströmung“ so: „Sie ist im Unterschied zu der ganz Diesseitigkeit und Helle atmenden homerischen Religion dem Dunkeln und dem Jenseitigen zugewandt, kennt Begriffe wie Sünde, Buße und Reinigung. Die in diese Richtung gehörenden Mysterienkulte (Eleusinische Mysterien, Dionysoskult, Orphik) trugen durchweg den Charakter von Geheimlehren ‒ woraus die spärlichen Kenntnisse der Nachwelt über sie zu erklären sind.“
Pythagoras war ein europäischer „Guru“
Einer der frühesten dieser heute noch dem Namen nach bekannten „spirituellen“ Philosophen war Pythagoras. Mathematikschülern ist er immer noch überwiegend als Erfinder einer ziemlich langweiligen geometrischen Binsenweisheit namens „a2 + b2 = c2“ in Erinnerung. Auch als Philosophen würden ihn viele noch einordnen können. Vom „Berufsbild“ her ist der ca. 580 v. u. Z. auf Samos Geborene allerdings alles andere als ein Philosoph im Sinne der heute gängigen Vorstellung von einem Schreibtisch-Eremiten oder trockenen Universitätsprofessor.
Viel treffender wäre es, Pythagoras mit dem indischen Begriff als „Guru“ zu beschreiben. Er betrieb eine Art „Sangha“, eine spirituelle Gemeinschaft, in der Schüler nach strengen Regeln leben mussten, um sich der stufenweisen Einweihung in die Geheimnisse des Kosmos würdig zu erweisen. Armut, Keuschheit und Gehorsam wurden ebenso gefordert, wie strenge Selbsterforschung, Gewaltverzicht und Verschwiegenheit. Tiere durften, ähnlich wie in der Yoga-Philosophie, nicht getötet werden. Frauen waren ‒ von der absoluten Vormacht des „Gurus“ einmal abgesehen ‒ gleichgestellt.
Hat sich Immanuel Kant in seiner Freizeit „kantianisch“ verhalten? Pythagoras jedenfalls muss ein Mann gewesen sein, der lebte, was er lehrte ‒ vor allem strenge Selbstbeschränkung und Selbstdisziplin. Historisch betrachtet bestand die Bedeutung seines „Bundes der Pythagoreer“ vor allem darin, dass er als religiöser „Orden“ den Versuch unternahm, philosophische Erkenntnisse unmittelbar im Rahmen eines Gemeinschaftslebens zu verwirklichen. Um welche Erkenntnisse geht es da?
Was mir mein Mathematiklehrer verschwiegen hat, ist die Tatsache, dass Zahlen und Formeln für Pythagoras zwar wichtig waren, dass er in ihnen jedoch nur die äußeren Widerspiegelungen geistiger Prinzipien sah, die überall im Kosmos gültig sind. So wie man von der Existenz der Dinosaurier heute nur noch durch die Skelette weiß, kennt man von diesem „Dinosaurier“ der griechischen Philosophie nur noch trockene Lehrsätze. Das „Fleisch“ fehlt ‒ teilweise deshalb, weil die Quellenlage keine genauen Rückschlüsse auf seine Lehre und Wesensart zulässt. So viel aber können wir sagen: Pythagoras war ein zutiefst spiritueller Mensch. Er glaubte an Seelenwanderung und daran, dass sich eine unsterbliche Menschenseele in einem langen Läuterungsprozess vom Kreislauf der Wiedergeburten selbst erlösen könne.
Die tiefe Bedeutung der Zahlen
Pythagoras war wahrscheinlich der Erste, der den Begriff „Philosophie“ im heute gebräuchlichen Sinn verwendete. Er verstand sich eben nicht nur als ein „Weiser“, sondern als ein „Liebhaber der Weisheit“.
Wissenschaft, Philosophie und Spiritualität sind heute streng getrennte Bereiche ‒ damals waren sie es nicht, ebenso wenig wie man die Astronomie von der Astrologie unterschied. Antrieb für den Philosophierenden war nicht so sehr Geltungssucht und Bildungsbeflissenheit, sondern ‒ wie Platon später sagen wird ‒ „Eros“.
Auch von den scheinbar trockenen Zahlen können wir annehmen, dass Pythagoras sie „liebte“. Zahlen hatten für ihn eine besondere Kraft und Bedeutung, sie repräsentierten das ganze Geheimnis der Schöpfung. Während man Zahlen heute als Gradmesser von Quantität betrachtet, bemühte sich Pythagoras eher um die Entschlüsselung ihrer Qualität.
Dieselben Gesetzmäßigkeiten sind wirksam im Aufbau des Kosmos wie im harmonischen Zusammenklang der Töne beim Musizieren. Die Welt ist aus Klang geboren ‒ ein Gedanke, der sich auch in vedischen Schöpfungsmythen wiederfindet. Und wenn die Engel in Goethes Faust singen: „Die Sonne tönt nach alter Weise in Brudersphären Wettgesang“, so ist diese Art der Beschreibung von Himmelskörpern in musikalischen Bildern zutiefst pythagoreisch.
Heraklit: „Alles fließt“
Rund vierzig Jahre nach Pythagoras, um 540 v. u. Z., wurde in Kleinasien ein weiterer Altmeister der griechischen Philosophie geboren: Heraklit. Man kennt ihn noch als Lieferanten von so beliebten Zitaten, wie „Alles fließt“, „Wir können nicht zweimal in denselben Fluss steigen“ oder „Der Krieg ist aller Dinge Vater“. Man kann Heraklit somit als geistigen Stichwortgeber von Darwin und Nietzsche verstehen, wegen der aphoristischen Kürze seiner erhaltenen Textbruchstücke, aber auch als westlichen Laotse oder auch als Begründer eines europäischen Monismus, einer Philosophie der Einheit all dessen, was existiert (in Indien auch als Advaita-Philosophie bekannt).
War Pythagoras ein „Guru“, so können wir Heraklit wohl als europäischen Prototyp eines Mystikers und Einsiedlers betrachten. Wie später Platon und die meisten Richtungen der Esoterik und Spiritualität war Heraklit von einem elitaristischen Geist durchdrungen. Er verachtete die Massen und die in seinem Land aufkeimende Demokratie. In seiner späten Lebensphase soll er buchstäblich abgeschieden in den Bergen gelebt und sich von Gras ernährt haben ‒ immer auf der Suche nach der einen Erkenntnis, die jeder Gelehrsamkeit zugrunde liegt. Diese eine Erkenntnis besteht im Wesentlichen darin, dass die Vielfalt der Erscheinungen der äußeren Welt nur eine Täuschung ist, dass dahinter eine höhere Einheit existiert, ein von Werden und Vergehen unberührtes ewiges Sein. Einen persönlichen Gott kannte Heraklit nicht. Wohl aber ein „Urfeuer“, das durch sein Aufflammen und Wiederverlöschen das unruhige Flackern der Erscheinungswelt sowie menschlicher Gefühle und Schicksale erzeugt. Heutzutage würde man eher von einer „Urenergie“ sprechen, die aller Schöpfung zugrunde liegt.
Dabei ist Heraklit, der große „Monist“, zugleich auch der große Verkünder der Vergänglichkeit und Veränderlichkeit allen weltlichen Lebens. Man weiß zwar nicht mit Sicherheit, ob der berühmte Spruch „Alles fließt, nichts besteht“ von ihm stammt, in seinem Sinn ist diese Erkenntnis aber mit Sicherheit.
In der von den Indern als „Maya“ bezeichneten Scheinwelt der vordergründigen Wirklichkeit gibt es nichts, was Bestand hat. Die harmonische Ganzheit, die im Kern aller Dinge bereits in Ewigkeit existiert, muss in der Außenwelt als beständiger Kampf und Widerstreit zwischen gegensätzlichen Kräften in jedem Moment wiederhergestellt werden. Jedes Ding, jedes Prinzip existiert nur in Relation zu seinem Gegenteil. Hell kann nur hell sein vor dem Hintergrund, dass auch Dunkelheit existiert.
Man kann hier den naturwissenschaftlichen Begriff des „Fließgleichgewichts“ anfügen, ebenso wie das Yin und Yang der chinesischen Philosophie und Hegels Dialektik ‒ das Prinzip der Evolution des Geistes durch den gedanklichen Dreisprung von These, Antithese und Synthese.
Ich glaube, man bräuchte weniger Raum, wollte man diejenigen philosophischen Richtungen aufzählen, die nicht in irgendeiner Weise auf Heraklit zurückzuführen oder mit ihm zu vergleichen sind. Sein Charakteristikum ist ja gerade die These, dass das Widersprüchliche am Ende doch zusammengehört. Die Einheit in der Vielheit und die Vielheit in der Einheit. Weisheit, wo sie eine gewisse Erkenntnishöhe erreicht hat, ist immer paradox.
Um einen letzten Vergleich aus einem anderen Kulturkreis anzuführen: „Leere ist Form, Form ist Leere“, sagt das buddhistische Herz-Sutra. Heraklit hätte dem wahrscheinlich zugestimmt.
Sokrates, die Ikone der Aufklärung
Als Blütezeit der griechischen Philosophie wird in der Regel die Epoche zwischen 470 (Geburt des Sokrates) und 322 (Tod des Aristoteles) bezeichnet. Die drei Philosophen Sokrates, Platon und Aristoteles, von denen jeweils der Ältere Schüler des Jüngeren war, prägten das Image des antiken Griechenlands wie nur wenige andere große Geister.
Während die Namen der ersten beiden Philosophen eng mit der berühmten perikleischen Ära in Athen (Lebenszeit des Perikles 493-429) verbunden ist, der kulturellen Blütezeit des „klassischen“ Griechenland, in der unsere heutigen Demokratien wurzeln, machte sich der Nordgrieche Aristoteles nicht nur als Philosoph, sondern auch als Erzieher des Diktators Alexander des Großen einen Namen.
Ich möchte diese Epoche bewusst nicht ausführlich behandeln, um Raum für weniger bekannte Philosophen zu schaffen, die mir ‒ speziell unter einem spirituellen Aspekt ‒ teilweise spannender erscheinen als die Klassiker. Sokrates ist mit seinem „Erkenne dich selbst“ zum Urvater der psychologischen Innenschau geworden. Sein „Ich weiß, dass ich nichts weiß“ liegt dem Agnostizismus zugrunde (der bewussten Nichtfestlegung in Glaubensfragen), ebenso wie einem Phänomen, das Ken Wilber die „aperspektivische Verwirrtheit der Postmoderne“ genannt hat. Es fehlt ein Standpunkt, von dem aus man die Welt einordnen und beurteilen kann ‒ für den Menschen unserer Zeit Fluch und Segen zugleich. So wurde Sokrates, bevor man die Schattenseiten der Säkularisierung und der weltanschaulichen Beliebigkeit erkannte, zur Ikone der Toleranz und der Aufklärung ‒ ein Heros der alle Untiefen der menschlichen Seele durchdringenden Ratio. Durch seinen aufrechten, beinahe freiwillig zu nennenden Tod, wurde er gar zu einer Art „weltlicher Jesusgestalt“. Lebendes Beispiel dafür, dass man dem Tod durch logische Überlegungen seinen Schrecken nehmen kann.
Wie wirklich ist die Wirklichkeit?
Von Platon sei hier unter dem spirituellen Fokus vor allem seine Ideenlehre erwähnt. An einem einfachen Beispiel will ich andeuten, worum es geht. Normalerweise nehmen wir an, der einzelne Apfel, den wir zu einem bestimmten Datum gekauft haben, der die Farbe rot hat und an einer Stelle wurmstichig ist, sei das eigentlich Reale.
Den Oberbegriff „Äpfel“ oder gar das noch allgemeinere „Obst“ halten wir dagegen für eine künstliche und nachträgliche Abstraktion, die der menschliche Geist vorgenommen hat. Platon meint im Gegensatz hierzu, dass die Idee „Apfel“ nicht nur vor den einzelnen Äpfeln da gewesen sei, sondern dass dieser Idee auch ein höherer Grad von Wirklichkeit zukommt als den konkreten Einzelstücken. Die platonische „Idee“ ist somit zugleich ein Gattungsbegriff und ein geistiges Urbild, ein Archetyp.
Das berühmte platonische „Höhlengleichnis“, in dem angekettete Menschen nur die Schatten der Dinge an der Wand vorbeiziehen sehen und diese für real halten, bezieht sich symbolisch auf den Unterschied zwischen Ideen und Einzeldingen. Wobei die konkreten Gegenstände ‒ das, was wir normalerweise für Wirklichkeit halten ‒ im Gleichnis als „Schatten“ verstanden werden. Nur die Ideen sind im eigentlichen Sinne real. Die häufig gezogene Parallele zwischen dem Höhlengleichnis und dem indischen Begriff der „Maya“ (Täuschung oder Illusion) ist teilweise irreführend. In der indischen Philosophie sind nämlich hinter dem Schleier der Maya keine Ideen (Urbilder) zu finden, sondern Leere, und diese gebiert wieder die Fülle der Erscheinungen. Platons spirituelle Bedeutung liegt vor allem darin, dass er die Existenz einer unsichtbaren geistigen Welt hinter den Erscheinungen plausibel dargelegt hat.
Das Denken von Platons Schüler Aristoteles markiert dagegen das Vorherrschen des Logischen, Rationalen, Einordnenden und Zergliedernden. Als solches hat es die christliche Scholastik (Thomas von Aquin) und die weltliche Wissenschaft geprägt. Zu spirituellen Höhenflügen lädt der große Verwissenschaftlicher der ursprünglich mystisch-esoterischen griechischen Philosophie nicht gerade ein. Seine Logik scheint alles Paradoxe aus dem Denken vertrieben zu haben. Eine Sache kann nicht zugleich a und b sein, Gegensätze schließen einander aus. Form könnte bei ihm niemals zugleich Leere sein. Zu Heraklits paradoxem Denken und Fühlen bildet Aristoteles den größtmöglichen Gegensatz.
Gottes verlorene Kinder
Allerdings ließ sich die spirituelle Strömung der griechischen Philosophie auch durch die lang andauernde geistige Vormachtstellung des Aristoteles nicht ganz unterdrücken. Im dritten Jahrhundert nach unserer Zeitrechnung, also fast schon in der Abenddämmerung des antiken Geistes, entstand in Rom ein letztes umfassendes und geniales philosophisches Konzept, das die abendländische Esoterik und Spiritualität bis in die unmittelbare Gegenwart wie kaum ein anderes geprägt hat. Sein Urheber war ein in Ägypten geborener Grieche namens Plotinos. Schon mit seinem Namen outete sich Plotinos als Anhänger des Platon. Er plante, in Italien eine Philosophenstadt namens Platonopolis zu gründen, die nach dem Vorbild von Platons „Staat“ gestaltet werden sollte. Das Projekt gelangte jedoch nie zur Verwirklichung.
Plotin bezeichnet den „Höchsten und Einen und Ersten“ als absoluten und unveränderlichen Urgrund alles Seienden. Indem das Eine „überfließt“ erschafft es aus seiner Substanz heraus alles, was existiert. Dabei geht Plotin von einer festen Rangordnung aus, die Wesen und Dinge einstuft, und zwar gemäß ihrer größeren oder geringeren Nähe zur Quelle. Als erste Ausstrahlung (Emanation) des Einen gilt ihm der Geist (ungefähr gleichbedeutend mit dem platonischen „Reich der Ideen“). Es folgen (in zunehmender Gottferne) die Weltseele, die Einzelseelen und als Letztes das Reich der Materie ‒ für den Philosophen das schlechthin Finstere und Böse.
Eine gewisse Verachtung gegenüber der sichtbaren Welt und allem Materiellen wohnt dieser Philosophie inne, asketische Leibfeindlichkeit und eine ablehnende Haltung gegenüber der Sexualität inbegriffen. Man muss aber würdigen, dass Plotins System ‒ ähnlich der Gleichung „Atman = Brahman“ in der indischen Philosophie ‒ eine zeitlose mystische Botschaft transportiert: Die Einzelseele ist wesensidentisch mit dem göttlichen Urgrund. Poetisch beschreibt Plotin die menschlichen Seelen als Kinder, die ihren Vater vergessen haben und sich lebenslang zu ihm zurücksehnen. Der Rückweg zum Einen verläuft aufwärts durch die Stufen der Schöpfung, die in umgekehrter Reihenfolge ihrer Entstehung durchlaufen werden müssen. Am Ende steht als große Verheißung die Wiederverschmelzung mit dem Göttlichen. Nicht Studium und die Einhaltung ethischer Regeln führen dort hin (obwohl alle diese Dinge nützlich sind), sondern die Versenkung in den eigenen göttlichen Wesenskern.
Wer sich die Grundzüge dieser Lehre zu Gemüte führt, ist vielleicht versucht, zu sagen: „Na und?“ Vieles davon kommt uns allzu bekannt, ja selbstverständlich vor. Dabei darf man aber nicht vergessen, dass es Plotins Verdienst war, diese „indisch“ anmutende Lehre erstmals in dieser Form für den Westen formuliert zu haben. Plotins Erben sind die gnostischen Lehren der großen christlichen Ketzerbewegungen, etwa die Katharer, die die menschliche Seele als gefangen im Gefängnis eines „bösen“ materiellen Körpers verstanden haben.
Die heutige spirituelle Populärliteratur enthält eine Fülle von neuplatonischen Ideen. Die Vorstellung vom „Aufstieg“ der Seele über eine Stufenleiter wachsender „Feinstofflichkeit“ bis hinauf zur größten erreichbaren Gottesnähe ist zutiefst „plotinisch“. Schattenseite dieser Lehre ist immer die Geringschätzung des Körpers, den eine stolze Seele ‒ ihrem Wesen nach nicht von dieser Welt ‒ gleichsam für unter ihrem Niveau hält.
Welcher dieser Philosophien wir uns auch nahe fühlen mögen oder uns ihr gar anschließen wollen, je tiefer wir in die Geisteswelt der Griechen einsteigen, desto mehr dürfte uns das so genannte New Age wie ein alter Hut vorkommen.

