Schreiben befreit die Seele
 Der Poet und Schriftsteller Peter Fahr sagt von sich, er überlebe nur schreibend: „Das Imaginäre ist die Luft, die ich atme. Wer fragt sich beim Atmen, ob es sinnvoll sei? Ich atme, also schreibe ich.“ Doch Poesie ohne überpersönlichen Sinn bleibe bloß Selbsttherapie. Damit Literatur wesentlich werde, brauche sie eine empathische Dimension: „Schreiben heisst lieben.“ Anmerkung der Redaktion: Peter Fahrs Lyrikband „Selten nur“ ist im Sturm-und-Klang-Shop erhältlich. Peter Fahr
Der Poet und Schriftsteller Peter Fahr sagt von sich, er überlebe nur schreibend: „Das Imaginäre ist die Luft, die ich atme. Wer fragt sich beim Atmen, ob es sinnvoll sei? Ich atme, also schreibe ich.“ Doch Poesie ohne überpersönlichen Sinn bleibe bloß Selbsttherapie. Damit Literatur wesentlich werde, brauche sie eine empathische Dimension: „Schreiben heisst lieben.“ Anmerkung der Redaktion: Peter Fahrs Lyrikband „Selten nur“ ist im Sturm-und-Klang-Shop erhältlich. Peter Fahr
Als zehnjähriger Knirps war ich ein begeisterter Sammler von Tierbildchen, die ich in ein Album klebte und sorgfältig beschriftete. Mit elf hortete ich Fotografien von Fußballspielern, Astronauten und Planeten. Mit zwölf tauschte ich Briefmarken und trug seltene Steine zusammen. Mit dreizehn begann ich zu malen – Lebensbilder festzuhalten. Und mit vierzehn entdeckte ich die Leidenschaft, Geschichten zu sammeln.
Als Junge wollte ich Chirurg werden. Da ich kein Blut sehen kann, operiere ich heute literarisch.
Irgendwann einmal habe ich den Versuch unternommen, schreibend aus der Einsamkeit auszubrechen. Seither scheitere ich immer wieder an dieser Sehnsucht. Schreiben befreit die Seele, macht den Einsamen aber noch einsamer.
Als ich zu schreiben anfing, sah ich in der Aussage das wichtigste Element des schöpferischen Akts. Verständlich, denn damals rang ich um Selbsterkenntnis, um die Kristallisation meiner Gedanken. Heute messe ich der Form eine größere Bedeutung bei. Was ich sagen will, wird angesichts der erfahrenen Relativität aller Aussagen zweitrangig. Das Wie interessiert mich immer brennender.
Ehrfurcht vor dem Mysterium
Bisher habe ich mich in der literarischen Arbeit stets darum bemüht, das Unmögliche, Unsagbare, Wesentliche zu beschreiben. Nun frage ich mich, ob es künstlerisch nicht sinnvoller wäre, das Wesentliche zwischen den Zeilen anzusiedeln – aus Ehrfurcht vor dem unbeschreibbaren Geheimnis des Lebens.
Das Elend der Menschen ist ihr Mysterium. Nichts vermag mich mehr zu fesseln als ihre Fesseln. Ich lebe als Pilger: ich pilgere unter Schlafwandlern und ergünde ihre Träume.
Ich gestehe, die magische Grenze nicht überwunden zu haben, die soziales Engagement von poetischer Schöpfung trennt: diesseits Kampf und Plage, jenseits ein Schweben im Kosmischen. Es ist mir noch nicht gelungen, diese Hürde zu nehmen, den Sprung von hier nach drüben zu schaffen. Meine Poesie versickert im Kleinkrieg für mehr Menschlichkeit wie Wasser im Wüstensand.
Ich greife an und will trotzdem geliebt werden. Manche Leser verwechseln die Kritik mit Unmut oder Traurigkeit. Sie stellen sich den Autor der angriffigen Texte wütend vor. Sie ahnen nicht, dass ich mir Kritik nur leisten kann, wenn Zuversicht mein Lebensgefühl bestimmt. Geht es mir schlecht, schweige ich. Bin ich traurig, mache ich Witze.
Da ich nicht fremdgehe, glauben die Freunde an meine Treue. Ich bleibe auch Ideen treu – das nennen sie dann Sturheit.
Bisher habe ich mich mit vergangenem Sein, bestenfalls mit gegenwärtigem auseinandergesetzt. Jetzt fasse ich die Beschäftigung mit der Zukunft ins Auge. Es geht darum, Entwicklungen vorwegzunehmen. Es genügt schon lange nicht mehr, vom Kommenden zu sprechen. Was not tut, ist wegweisende Literatur, die zu ebensolchen Handlungen inspiriert. Ich bin herausgefordert, ein Chronist der Zukunft zu werden.
Wäre ich gläubig, könnte ich sagen: Schreiben ist meine Art von Gottesdienst.
Schreiben heißt lieben
Der Schriftsteller schreibt.
Den Punkt, an dem man sich für oder gegen den Schriftstellerberuf entscheidet, gibt es nicht. Schreiben heißt lieben. Wie der Liebende um sein erhabenes Gefühl kämpft, wie er seine Liebe täglich bejahen muss, damit sie lebt, so bemüht sich der Schreibende um seine Literatur. Ebensowenig wie die Liebe ist die Literatur ein sanftes Ruhekissen.
Der Schriftsteller hat den Anspruch, seine Vorstellungen öffentlich zu machen. Seine Berufung berechtigt den Anspruch.
Sprechen – aus Furcht vor dem Altbekannten, aus Angst vor dem Künftigen. Schreiben ist zaghaftes Sprechen.
Literatur ist die Sprache der Schüchternen. Sie gleicht dem Beschwörungstanz Eingeborener, die ihre Gottheit zu besänftigen suchen.
Sprache ist der Kompromiss zwischen Sprecher und Zuhörer, zwischen Schreiber und Leser, ist Transportmittel von Unaussprechlichem, von Kompromisslosem.
Das Wort leitet Energie
Schreiben ist ein Prozess. Das Werk stellt nur einen Bruchteil davon dar.
Der Schreibende empfängt das Wort. Das Wort leitet Energie. Energie ist wirkende Kraft. Kraft verändert Materie.
Der Schreibende setzt Wirklichkeiten um in neue Wirklichkeiten. Er erzählt Geschichten von sich und Anderen für sich und Andere.
Literarischer Inhalt ist Auffassungssache, literarische Form Geschmacksache. Inhalt und Form bedingen und bestimmen einander.
Literarische Provokation hat nur dann einen Sinn, wenn sie zum Denken anregt.
Wer gegen etwas anschreibt, schreibt immer auch für etwas.
Der Schriftsteller ist verantwortlich für seinen Text, der Leser für dessen Lektüre. Der Schriftsteller darf für die Lektüre seines Textes nicht zur Rechenschaft gezogen werden. Seine Aufgabe ist es, zu schreiben, und seine Pflicht, diese Aufgabe so gewissenhaft wie möglich zu erfüllen.
Wer die Eltern für die Taten ihres Kindes verantwortlich macht, beleidigt das Kind. Wer den Schriftsteller auf die Wirkung seines Textes behaftet, entmündigt den Leser.
Wahn und Wirklichkeit
Was zum ersten Mal erlebt wird, ist neu, aufregend, rätselhaft, zwingend. Erst die Wiederholung des Erlebten ermöglicht literarische Stoffe. Erst wenn gelebtes Leben ins Bewusstsein rutscht, ist die nötige Distanz zur Wirklichkeit gewonnen, die Relativierung seiner selbst, ohne die es keine Literatur geben kann.
Disziplin und Geduld sind das Rüstzeug des Schreibenden, Gedächtnis und Fantasie die Grundlagen seiner Arbeit. Trott tötet das Gedächtnis, Langeweile die Fantasie: Der Schreibende verweigert sich dem Alltag.
Die Presse reagiert auf Wirklichkeit, die Literatur nimmt sie vorweg. Der Journalist braucht Tatsachen, um schreiben zu können – er verarbeitet Vergangenes. Der Schriftsteller beschwört Möglichkeiten, öffnet sich Künftigem – er vertraut Visionen.
Der Schriftsteller lebt zwischen Wahn und Wirklichkeit, auf dem gefährlichen Grat der Fantasie. Es ist seine Aufgabe, die Summe der alten Legenden um neue zu bereichern.
In dieser Zeit der maßlosen Information und des fehlenden Bewusstseins der Zusammenhänge besinnt sich der Schreibende auf das Einfache. Er macht aufmerksam auf das Wesentliche, auf die Verknüpfung von Vorstellungen. Er bringt es fertig, die Fantasie des Lesers aus dem Schlaf des Alltags aufzuschrecken, sie aber nicht ins Korsett der eigenen Vorstellungen zu zwängen, sondern anzuregen und sich frei entwickeln zu lassen.
Literatur ohne überpersönlichen Sinn ist Selbsttherapie.
Die Analyse des Schriftstellers darf – will sie Einsichten vermitteln – keineswegs beschränkt sein auf gesellschaftliche Zustände und deren Entwicklungen. Sie muss auch die Menschen erfassen, die diese Zustände geschaffen haben. Die Wahrheit offenbart sich am Menschen.
Die Anarchie der Fantasie
Gelegentlich erkenne ich den ungeheuren Reichtum, den der Geist darstellt, seine ungezählten Möglichkeiten, seinen Adel. Der Geist läßt die Grenzen der Wahrscheinlichkeit weit hinter sich und erhebt sich von der Tatsache über die Idee hinaus ins Ideal. Aber ebenso oft erkenne ich, dass eine Tat – und sei sie noch so unbedeutend – Idee und Ideal überflügelt, weil sie Geist und Materie im Schöpfungsakt vereinigt.
Erst der Spatenstich macht aus Brachland Acker.
Die Theorie kann vollkommen sein, die Tat nie.
Um eine revolutionäre Idee zu verwirklichen, braucht es in erster Linie eine Handvoll Illusionen. Doch nur die Bereitschaft, zwischen Illusion und Wirklichkeit zu unterscheiden, befähigt zum Handeln. Ohne die klare Trennung von Sehnsucht und Erkenntnis gibt es keine Tat.
Wer eine Tat vollbringt, wird um eine Illusion ärmer und eine Erfahrung reicher.
Die Stunden vergehen und Fremde kommen an. Willst du etwas tun: nimm dir Zeit und lass die Freunde gehen.
Die Schlange streift sich die alte Haut erst ab, wenn die neue nachgewachsen ist.
Fantasie erwacht, wo Tod und Wiedergeburt miteinander ringen. Fantasien zeugen davon, dass etwas absterben muss, weil etwas Anderes entstehen soll. Fantasie kündigt Veränderung an, die der Wille verwirklicht.
Veränderung setzt Bewegung voraus, Unruhe, manchmal sogar Chaos. Nicht die Satten und Geduldigen sorgen für Fortschritt, sondern die Hungrigen und Getriebenen. Nicht das Moderate, Schickliche, Vernünftige setzt etwas in Gang, sondern das Unanständige, Radikale, Unvernünftige. Neue Ideen verdanken wir nicht den Profilierten und Mächtigen, sondern den Ohnmächtigen, die sich einmischen. Nur der Geist der Auflehnung verändert die Welt.
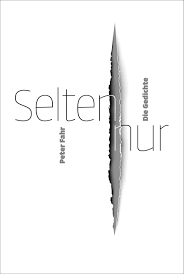
Peter Fahr: Selten nur. Die Gedichte, Münster Verlag, 384 Seiten, Euro 24,80
Erhältlich im Sturm & Klang-Shop:


Tja, nur der vergleichsweise hohe Preis (für sehr viel Buch!) wird wohl viele abhalten, sich dieses Band anzuschaffen.
Was nicht gegen das Buch spricht, aber gegen die Verhältnisse, die es vielen unmöglich machen wird, sich diese Gedichte anzuschaffen.
Schade!
Gruß – Volker
Oder sind das gar nicht die Dichter der Linken, sondern nur Denker und Fühler und Leutre, die sich momentan Gesunsstoßen und – schreiben, denen aber das soziale Leid der unteren Klasse am Arsch vorbei geht?
Und er wird die Welt nicht ändern und froh sein, wenn er sich weiter schöne Mäntel kaufen kann.
Und ich findes das eine Gedicht, dass ich von ihm gelesen habe, auch alles andere als poetisch.
Er hat äußerlich so ein bisschen was von Martin Suter – aber sonst fehlt der Tiegang.
Viele liebe Grüße.
Nicht zu fassen