Was sollen wir tun?
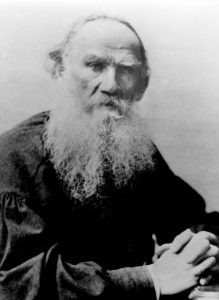
Lew Nikolajewitsch Tolstoi
Tolstoi als Wirklichkeitsbeschwörer und politischer Führer. Der Autor von „Anna Karenina“ und „Krieg und Frieden“ war nicht nur ein großer literarischer Weltengestalter, sondern privat auch eine Art Guru, jemand, der sich massiv in die Themen seiner Zeit einmischte. Schriften u.a. zum Justizsystem, zum Bodenrecht und zum Tierschutz zeugen davon. Andererseits sah Tolstoi die Problematik von zu pamphlethafter politischer Kunst und warnte, „dass der ästhetischen Qualität nichts abträglicher ist als das Einsickern gesinnungs- und bekenntnishafter Momente.“ Der Literaturwissenschaftler Jürgen Wertheimer behandelt in seinem Kapitel aus „Weltsprache Literatur“ am Beispiel Tolstois die Gestalt des Schriftstellers zwischen Engagement und Kulturschöpfung. (Jürgen Wertheimer)
Gelegentlich sind weltliterarische Beziehungen und Bezüge weit mehr als Dokumente einer „bloß“ persönlichen Begegnung. Man könnte eher sagen, die Literatur, der literarische Text ist letztlich nur das Medium eines sehr viel tieferreichenden Kontaktereignisses. Der Kontakt über Raum und Zeit hinweg entsteht nicht auf der Basis einer Botschaft, sondern gründet auf so etwas wie strukturellem Wiedererkennen. Wenn man so will eine mentale Begegnung auf Augenhöge, was den – nicht nur literarischen – Geltungsanspruch betrifft.
Ohne es sich recht eingestehen zu wollen, sucht Tolstoi in Weimar auf den Spuren des zum Monument gewordenen Goethe nach einer imaginären Verwandtschaft. Verwandtschaft zwischen zwei Autoren wie sie unterschiedlicher nicht sein können. Hier die Weimarer Legende, Klassizismusikone, dort der charismatische Großgrundbesitzer. Goethe: ein nobles Relikt des 18. Jahrhunderts mit der Fähigkeit, Tendenzen und Entwicklungen des 19. Jahrhunderts zu ahnen: Industrialsierung, Kapitalismus, Klassenkonflikte, Maschinenwelt. Tolstoi: ein Archivar des 19. Jahrhunderts mit Vorstellungen und Idealen aus den Arsenalen des 18. Jahrhunderts: der Idee eines rationalistischen Christentums, einer patriarchalisch geordneten, sozial gerechten Welt. Treffen hier Welten aufeinander, oder kommen nicht eher zwei scheinbar unterschiedliche Welten miteinander in Berührung?
Beide verbindet das System, sich selbst als Welt zu setzen, die Welt in sich zu verkörpern. Bei Goethe war es die Fähigkeit, eine Art von Haltung der Welt gegenüber einzunehmen. Eine Art von professionellem Nichtengagement. Vielleicht die sozialisierte Art und Weise, die Welt nicht unmittelbar an sich herankommen zu lassen. Bei Tolstoi findet sich das genaue Gegenteil: den Zustand der Welt genau zu lesen und zu leben: hautnah von ihr berührt zu werden, und der Versuch, auf sie Einfluss zu nehmen. 1828 in Jásnaja Poljána geboren, wird Leo Tolstoi nahezu sein ganzes Leben im Bannkreis seines Gutes verbringen und von dort aus versuchen, die Welt zu verändern. Immer wieder wird ihn dabei die Frage „Was soll man tun?“ beschäftigen. Umtreiben. So heißt auch seine 1886 beendete Denkschrift: „Was sollen wir tun?“ Tolstoi zitiert hier nicht nur das Lukas-Evangelium, sondern die Fragen, um die beinahe die gesamte russische Literatur des 19. Jahrhunderts kreist.
Ausgehend von den bedrückenden Einsichten in die Welt der Bettler und Huren, der Trunksucht und Verelendung, die er als Teilnehmer an der Volkszählung von 1882 in Moskau gewonnen hat, konstatiert er: Wir leben falsch! und leitet mit faszinierendem Radikalismus umfassende Reformen auf allen Lebenssektoren ein. Tankred Dorst spielt und spinnt in seinem gleichnamigen Stück (Was sollen wir tun?) Tolstois Gedanken konsequent weiter und führt sie illusionslos zum bitteren Ende. Gregor Ziolkowski resümiert:
Selbst im engsten Familienkreis kollidiert die uneigennützige Moral, das Verteilen von Eigentum, die Suche nach Gleichberechtigung […] mit den Schranken der Gesellschaft. Der Alte wird zum schrulligen Eremiten im eigenen Haus. Aber auch der geliebten „Gegenseite“, den Landstreichern, Bauern und Knechten, kann sich der Utopist kaum verständlich machen. So kommt in den Dialogen eine tragikomische Heiterkeit auf, ein jeweiliges Aneinander-Vorbeireden […].
Auch in einem weiteren Stück, Akrobaten zeigt Dorst die Unvereinbarkeit von Tolstois Morallehren mit der eigenen Zeit auf:
Alexej, der „untolstoianische“ Sohn Tolstois, kommt als mittelloser Emigrant nach Amerika. Von einem inzwischen erfolgreichen Zirkusunternehmer, der vor Jahrzehnten als Tolstoianer den Segen des Alten vor der Abreise erbeten hatte, erhofft er sich Hilfe.
Und erhält sie auf groteske Art: Auf Grundlage seiner Ähnlichkeit mit dem Vater, wird Alexej zur lukrativen Theater-Attraktion, zum Show-Act:
Umrankt von russischen Birken soll „Tolstoi“ vor einem Las-Vegas-Publikum stumm auf der Bühne erscheinen, mit eben jenem Blick, den man einst als die Kraft seiner Seele interpretiert hat. Tankred Dorsts „Variationen“ bilden eine Absage an Heilsbotschaften.
So verständlich und vergnüglich diese phantasievolle Absage an Heilsbotschaften jeder Art auch anmutet, sie führt in der Frage nicht weiter. Und diese Frage lautet nach wie vor: Was können wir tun, um die Missstände in dieser besten aller möglichen Welten wenn nicht zu beseitigen, so doch zu lindern? Und wie verhält sich Moral zu Kunst? Auch hier wäre es einfach und verführerisch, auf die grundsätzliche ideologische Standpunktlosigkeit literarischer Texte zu verweisen. Auch könnte man anführen, dass der ästhetischen Qualität nichts abträglicher ist als das Einsickern gesinnungs- oder bekenntnishafter Momente. Eine Gefahr, der Tolstoi in seinem literarischen Werk kaum je erliegt. Wenn dort Elend, Gemeinheit, Ungerechtigkeit, Verzweiflung und exzessive Gewalt dargestellt werden, so geschieht dies jeweils in einem Gesamtkontext, der das Phänomen von unterschiedlichen Seiten beleuchtet und darstellt. Anders in Tolstois programmatischen Texten, wo er eindeutig und kompromisslos Position bezieht. In der Erzählung „Kreutzersonate“ wird der der Moment des Mordes in eindringlicher Ambivalenz minutiös und schonungslos geschildert:
Da packte ich sie, ohne den Dolch loszulassen, mit der linken Hand an der Kehle, warf sie hinten über und begann sie zu würgen. Was für einen feisten Hals hatte sie doch! Sie faßte mit beiden Händen nach meinen Händen, suchte ihren Hals zu befreien, und als wenn ich das erwartet hätte, stach ich sie aus aller Macht mit dem Dolche unterhalb der Rippen in die linke Seite …
Wenn die Leute behaupten, daß sie in einem Wutanfall nicht wissen, was sie tun, so ist das unsinnig und unwahr. Ich wußte alles, nicht für einen Augenblick verlor ich das klare Bewußtsein. Je stärker ich selbst in mir meine Wut anfachte, desto greller leuchtete das Licht des Bewußtseins in mir auf, das mich alles das deutlich sehen ließ, was ich tat. Ich kann nicht sagen, daß ich alles voraus wußte, was ich tun würde, in dem Augenblick jedoch, da ich handelte, ja vielleicht noch ganz kurz vorher, wußte ich, was ich tun würde, und hatte gar noch, im Falle des Bereuens, die Möglichkeit, einzuhalten. Ich wußte, daß ich sie unterhalb der Rippen treffen und daß der Dolch dort eindringen würde. Im Augenblick, da ich es tat, wußte ich, daß ich etwas Entsetzliches tue, etwas, das ich noch nie getan und das noch furchtbarere Folgen haben würde. Aber dieses Bewußtsein fuhr nur wie ein Blitz durch mein Hirn, und diesem Blitz folgte sogleich die Tat. Die Tat selbst spiegelte sich im Bewußtsein mit ungewohnter Grellheit. Ich spürte den jähen Widerstand des Korsetts und noch irgendeines Gegenstandes, hörte irgendeinen Laut und fühlte dann das Eindringen der Klinge ins Weiche. Sie griff mit den Händen nach dem Dolche, schnitt sich dabei und ließ los. Ich habe später im Gefängnis, nachdem die sittliche Wandlung sich in mir vollzogen hatte, lange über diesen Augenblick nachgedacht und mir davon ins Gedächtnis zurückzurufen versucht, was ich nur irgend konnte.
Die Episode zeigt anschaulich, mit welcher Präzision und Dichte unterschiedliche Tat- und Bewusstseinsmomente ineinandergreifen und sich zum Teil konterkarieren. So, dass der Gewaltakt zugleich lustvoll re-evoziert, verurteilt und reflektiert wird. Von all dieser Ambivalenz und Doppelbödigkeit des Durchdringens ist in den programmatischen Texten Tolstois absolut nichts zu spüren. Dieser andere Tolstoi beginnt bereits im Nachwort der eben zitierten Kreutzersonate, wenn er anmerkt:
Der Schluß, der nach meiner Meinung naturgemäß daraus zu ziehen ist, geht darauf hinaus, daß man sich dieser Verirrung und Täuschung nicht hingeben dürfe. Und um sich ihnen nicht hinzugeben, darf man erstens unsittlichen Lehren, durch welche vermeintlichen Wissenschaften sie auch gestützt werden mögen, keinen Glauben schenken, und muß zweitens begreifen, daß die Unterhaltung eines Geschlechtsverkehrs, bei dem die Geburten absichtlich verhindert werden oder die Sorge für die Kinder auf die Frauen abgewälzt oder die Möglichkeit des Gebärens von vornherein verhindert wird – daß ein solcher Geschlechtsverkehr eine Übertretung der einfachsten Forderung der Sittlichkeit, mithin selbst eine Unsittlichkeit ist, und daß ledige Leute, die nicht unsittlich leben wollen, sich dieses Verkehrs enthalten müssen.
Der einfühlsame Analytiker der Erzählung verwandelt sich in gleichermaßen naiven wie erfahrenen Katecheten – und es macht wenig Sinn, den einen gegen den anderen auszuspielen. Fakt ist, beide Seiten sind Teile einer Persönlichkeit und die Wirkmächtigkeit des Phänomens Tolstoi ergibt sich aus dem Zusammenspiel beider Komponenten. Und Tolstoi weiß, dass er mit dieser Doppelsignatur leben muss. So notiert er am 21. September 1884:
Ich dachte viel an mich. Ich bin ein äußerst schlechter und lasterhafter Mensch. Ich habe alle Laster und diese zu einem hohen Grad: Neid, Habsucht, Gemeinheit, Sinnlichkeit, Eitelkeit, Ehrgeiz, Stolz und Bosheit. Nein, nicht Bosheit. Meine einzige Rettung ist, daß ich weiß, wie ich bin und ich kämpfe, ich habe mein ganzes Leben dagegen gekämpft. Deswegen nennen sie mich einen Psychologen.“
Schon im April 1876 – während der Arbeit an Anna Karenina – kommt diese fast schizophrene Süchtigkeit nach Sinnsuche in einem Brief an eine Freundin noch stärker zum Ausdruck:
Sonderbar und entsetzlich ist es auszusprechen, ich glaube an nichts, an nichts, was von der Religion gelehrt wird, und gleichzeitig hasse ich nicht nur den Unglauben, sondern verachte ihn. Ich kann nicht begreifen, wie man ohne Glauben leben kann, und noch weniger, wie man ohne Glauben sterben kann. Ich konstruiere mir allmählich meine eigenen Glaubensinhalte, aber wie sicher ich ihrer auch sein mag, sie sind nicht sehr sicher und überzeugend. Wenn mein Verstand fragt, ist die Antwort zufriedenstellend; aber wenn mein Herz leidet und einer Antwort bedarf, bekommt es weder Unterstützung noch Trost.
So greifen Selbstbeobachtung und Selbsthass, obsessive Egomanie und überbordender Altruismus auf eine bisweilen verstörende Art ineinander. Hass auf die Gesellschaft und Such nach ihr gehören ebenso zu diesem Lebensroulette wie Selbstvorwürfe und qualhaft akribische Dokumentation wie in diesem Tagebuch von 1851:
31. März: Kein Tagebuch geführt, gelesen, wenn auch spät. Bis 12 über Rechnungen gesessen. Von 12 bis 2 mit Begitschew gesprochen, viel zu offen, voll Eitelkeit und mich selbst betrügend. Von 2 bis 4 Turnen. Zu wenig Härte und Geduld. Von bis 6 zu Mittag gegessen und unnötige Einkäufe gemacht. Zu Hause nichts geschrieben, Faulheit. Konnte mich lange nicht entschließen, zu den Wolkonskis zu fahren. Dort dann ohne Mark gesprochen. Feigheit. Habe mich schlecht gehalten. Feigheit, Eitelkeit, Unüberlegtheit, Schwäche, Faulheit […]
5. April, Pirogowo: Am Vormittag gut gearbeitet, dann auf die Jagd und nach Pirogowo gefahren, ohne rechten Grund. Bei Serjosha habe ich gelogen, war eitel und feige. Arbeitsplan für den 6. Von 5 bis 10 schreiben. Von 10 bis 11 Messe. Von 12 bis 4 Mittag. Von 4 bis 6 lesen. Von 6 bis 10 schreiben.
6. April: Nichts erfüllt. Habe gelogen, war sehr eitel und in der Kirche ganz und gar nicht bei der Sache. […]
17. April: Nichts geschrieben – die Faulheit hat gesiegt! […]
18. April: Konnte mich nicht bezähmen, machte einem rosafarbenen Wesen, das mir aus der Entfernung sehr schön erschien, ein Zeichen und öffnete hinten die Tür. Sie kam. Ich kann sie nicht ausstehen, spüre Widerwillen, Ekel, ja Haß, weil ich ihretwegen meinen Regeln untreu werde. Überhaupt empfinden wur gegen Menschen, denen wir nicht zeigen können, daß wir sie nicht mögen, und die zu der Annahme berechtigt sind, wir hegten Zuneigung für sie, ein Gefühl, das sehr dem Haß ähnelt. – Pflichtgefühl und Abscheu sprachen dagegen. Lüsternheit und Gewissen dafür. Letztere behielten die Oberhand.
Entsetzliche Reue; habe sie noch nie so heftig empfunden. Das ist ein Schritt nach vorn.
Die Suche, ja Sucht nach dem richtigen Weg kennt keine Rücksicht – bis über die Grenze der Lächerlichkeit hinaus: der wohl glaubwürdigste Beweis für die Echtheit einer Haltung. Als Narr in Christo krempelt er im Bauernkittel sein Gut um und versucht mit gleichem Ernst die ganze Welt zu revolutionieren. Konfrontiert mit einer Gesellschaft aus Posen und einer Kunst aus Posen und Imitaten unternimmt er es nach den Originalen zu suchen. Tolstoi wird seine rückwärtsgewandte Utopie der „Volkskunst“ kreieren. Eine Kunst, deren einziger Maßstab in einer erlösenden Befreiung aus der sterilen Hermetik der kopierten Gefühle zu suchen ist. Auf der Basis der kollektiven Vermittlung „aufrichtiger“ (nicht „schöner“ oder „guter“) Gefühle soll eine neue emotionale Kultur der Aufrichtigkeit entwickelt werden; soll jener sozialisierende Effekt angeregt werden, der auf der Basis einer Schule der Affekte in „Befreiung der Persönlichkeit aus der Isolierung“, im „Verschmelzen der Persönlichkeit mit anderen“ (so in Was ist Kunst?) seine Zielvorstellung andeutet.
Auch im Inneren des Romanwerks versucht der Moralist Tolstoi eine Alternative zu skizzieren, ohne auf ein billiges Schwarz-Weiß-Schema ausweichen zu müssen. Er schildert ja auch nicht nur eine Zweier- oder Dreier-Beziehung, sondern leuchtet ein ganzes gesellschaftliches Panorama mit sehr vielen Figuren aus. Unter ihnen als Kontrast- und Vergleichspaar herausragend Lewin und Kitty; zwei, die ich aus dem Society-Sog herauslieben. Auch oft am Rand des Selbstmords. Beinahe aufgerieben. Doch nur beinahe, – bevor Lewin und auch Kitty ihre Existenz, ihre Rolle im Leben von Grund auf neu zu definieren beginnen: er als Bauer und Teil des „Volkskörpers“, sie als Mutter. Sicher: Der Roman begibt sich hier in die Nähe des Gesinnungshaften: Glaube, Hoffnung, Liebe tauchen allmählich, wie etwas längst Vergessenes, kaum mehr Erinnertes im kollektiven Halbbewusstsein der Seelen wieder auf. Im Fall von Tolstois großem Werk ist das mit peinlichen Gefühlen verbunden, nicht aufgesetzt. Denn Lewin und Kitty arbeiten, leben und lieben sich in ihre neuen Lebensentwürfe quälerisch, selbstquälerisch, nicht widerspruchsfrei und mit großer Ernsthaftigkeit hinein. Ebenso ernsthaft und radikal wie ihr Autor, der keine Idylle oder Liebe auf christlicher Sparflamme predigt. Oder etwas irgendwie vernünftelnd Kastriertes, Kleinbürgerlich-Religiöses.
Und Tolstoi wusste, wovon er sprach. Seine persönliche Kreutzersonate mit seiner Frau füllt Tagebuchbände. So notiert er fast in der Art einer Emma Bovary: „Als ich mich heute meiner Hochzeit erinnerte, dachte ich, es war eine Art Verhängnis. Ich bin auch nie verliebt gewesen. Musste aber unbedingt heiraten.“ Der Rest ist Leiden: Vierzig Jahre Kampf, Krampf, Hass, Schuldgefühl, Reueanfälle, Selbstmorddrohungen, Verfolgungen, Versöhnungen, Fluchten, Rückkehren; Betrug, Verfluchung, Verzeihung, Schwangerschaft in Folge. All das mutet gelegentlich tragikomisch an. Freilich nur aus der Entfernung. Aus der Nähe erlebt ist es die Hölle. Nein, da ist sich Tolstoi sicher, innerhalb des Regelwerks der haltlosen Fassadengesellschaft, die er kannte, war keine Lösung zu erwarten: Wo die Oberfläche einer Sache vergöttert und die Substanz verkauft wird, ist nichts zu erhoffen. Diese Privatkatastrophen und diese Katastrophen des Privaten sind auch und vor allem ein Klassenphänomen. Die „Internationale“ der Bourgeoisie hatte die Menschen im Griff. Im Würgegriff, ob in Moskau oder Paris. Sie, die Gesellschaft, verwaltet und beherrscht selbstredend auch den Kunstmarkt, ja, betrachtet Kunst als Markt.
Tolstois Ziel: Die Kunst wieder den Gesetzen des Marktes zu entreißen und ihrer eigentlichen Aufgabe zuzuführen. Er weiß sowohl, was der Auftrag von Kunst ist, als auch, was nicht zu ihrer Bestimmung gehört – wenngleich sie genau mit diesen Mitteln Erfolg hat und die Massen bedient. In seinem schon zitierten Aufsatz Was ist Kunst von 1898 schreibt er:
Ein einmal empfundenes Gefühl erneut in sich hervorzurufen und, hat man es in sich hervorgerufen, es vermittels Bewegungen, Linien, Farben, Tönen oder in Worten ausgedrückter Bilder so wiederzugeben, daß andere ganz das gleiche Gefühl empfinden – hierin besteht das Wirken der Kunst. Kunst ist eine menschliche Tätigkeit, die darin besteht, daß ein Mensch durch bestimmte äußere Zeichen anderen die von ihm empfundenen Gefühle bewußt mitteilt und daß andere Menschen von diesen Gefühlen angesteckt werden und sie erleben. […] Kunst ist nicht, wie die Metaphysiker sagen, die Manifestation irgendwelcher geheimnisvollen Ideen von Schönheit oder Gott; sie ist nicht, wie die ästhetischen Physiologisten sagen, ein Spiel in dem der Mensch seinen Überfluß an aufgestauter Energie entlädt; sie ist nicht der Ausdruck der Emotionen des Menschen durch äußere Zeichen; sie ist nicht die Herstellung gefälliger Objekte; und sie ist vor allem kein Vergnügen; sondern sie ist ein Mittel der Einung der Menschen, indem sie sie in gleichen Gefühlen aneinander bindet, und sie ist unerläßlich für das Leben und den Fortschritt der einzelnen und der Menschheit zum Guten. […] Kunst ist eine menschliche Tätigkeit, die darin besteht, daß ein Mensch bewußt, mit Hilfe äußerer Zeichen, anderen Gefühle vermittelt, die er durchlebt hat, und daß die anderen von diesen Gefühlen angesteckt werden und sie ebenfalls an sich erfahren. […] eines anderen Freude zu genießen, den Kummer eines anderen schmerzlich zu empfinden und die Seelen miteinander zu vermischen […]
Der absolute Primat auf das Gefühl, das gemeinschaftlich hervorgerufene und auf ein Kollektiv übertragene echte Gefühl, ist Tolstois wichtigstes, ja, einziges Kriterium, um Kunst zu beurteilen. Wieder und wieder repetiert und erweitert er das Credo seiner „volksnahen“ Poetik in einer Vielzahl ästhetischer Schriften, wobei der klassenkämpferische soziale Aspekt immer stärker hervortritt:
… dann wird verständlich, daß echte Kunst nicht eine Kunst sein kann, die einer exklusiven Minderheit gefällt, sondern die, die der arbeitenden Mehrheit gefällt, da heißt auf sie wirkt. (aus: Über das, was Kunst genannt wird)
Ein nicht unproblematischer Denkweg, der ihn in eine ideologisch nicht unbedenkliche antiformalistische und kollektivistische Richtung führt:
Deswegen sind das künftige Vollkommenheitsideal nicht die Exklusivität […] sondern ganz im Gegenteil Kürze, Klarheit und Einfachheit des Ausdrucks. Und erst dann […] wird sie zu dem, was sie sein soll – ein Werkzeug, das religiös-christliches Bewußtsein aus dem Bereich der Vernunft, Urteilskraft und Gefühl versetzt und die Menschen dadurch in der Wirklichkeit, im Leben selbst jener Vollkommenheit und Einigkeit näherbringt […] (Ästhetische Schriften, S. 212)
Auch krasse Fehlurteile, wie etwa seine radikale Ablehnung Shakespeares als unnatürlich, elitär und verkünstelt. Ich meine dennoch, dass dies alles, der Don-Quichote-artige Kampf gegen meisterliche Formen, artistische Virtuosität, die punktuell von ihm selbst durchschaute Widersprüchlichkeit und Hilflosigkeit bei der Kontaktaufnahme mit dem Prekariat zum unverwechselbaren Profil dieses Künstlers integral gehört. Kein Geringerer als Lenin bestätigt in seiner kritischen, klarsichtigen Würdigung due innere Widersprüchlichkeit als Signatur und Spiegelung der Befindlichkeit nicht nur des Autors, sondern der russischen Gesellschaft. In Tolstoi im Spiegel der Russischen Revolution schreibt er:
In den Werken, Anschauungen, Lehren und in der Schule Tolstojs sind tatsächlich schreiende Widersprüche enthalten. Einerseits ein genialer Künstler, der nicht nur unvergleichliche Bilder aus dem russischen Leben, sondern auch erstklassige Werke der Weltliteratur geliefert hat. Anderseits ein Gutsbesitzer, der sich als Narr in Christo gefällt. Einerseits ein wunderbar starker, unmittelbarer und aufrichtiger Protest gegen gesellschaftliche Verlogenheit und Falschheit, anderseits ein „Tolstojaner“, das heißt ein verschlissener, hysterischer Jammerlappen, der sich russischer Intellektueller nennt, sich öffentlich an die Brust schlägt und sagt: „Ich bin schlecht, ich bin ekelhaft, aber ich lasse mir die sittliche Selbstvervollkommnung angelegen sein: ich esse kein Fleisch mehr nähre mich jetzt von Reiskoteletts.“ […] Daß Tolstoj angesichts solcher Widersprüche sowohl die Arbeiterbewegung und ihre Rolle im Kampf für den Sozialismus als auch die russische Revolution absolut nicht verstehen konnte, liegt […] auf der Hand. Aber die Widersprüche in den Anschauungen und Lehren Tolstojs sind keine Zufälligkeiten, sie sind vielmehr ein Ausdruck jener widerspruchsvollen Verhältnisse, in denen sich das russische Leben des 19. Jahrhunderts abspielte. Das patriarchalische Dorf, gestern erst von der Leibeigenschaft befreit, wurde dem Kapital und dem Fiskus buchstäblich mit Haut und Haar zur Ausplünderung überlassen.
Der ergreifende Bericht Tolstojs über die die erwähnte Volkszählung markiert im Übrigen mit großer Klarheit die Grenzen und Zuwendungspannen, wenn Graf und Gosse zusammenzukommen versuchen. Freilich zeigt er sich von diesen Anfangsschwierigkeiten unbeeindruckt und erprobt im Weiteren auf seinem Gut eine ganze Reihe überaus konkreter Maßnahmen wie die Einrichtung neuartiger Kindergärten und Schulen. Dabei inspirieren und motivieren ihn auch kleinste Erfolge. Wie beispielsweise diese Episode, weil er hier erste Regungen autonomen Sprechens und Denkens zu beobachten glaubte:
Neulich gelang es mir, ein solches Aufblühen des Verständnisses bei einem sehr schüchternen Mädchen zu beobachten, die einen ganzen Monat geschwiegen hatte. Herr U. erzählte, und ich war Zuhörer und Beobachter. Als alle zu erzählen begannen, bemerkte ich. daß Marsutka von der Bank herabkroch mit einer Bewegung, die anzuzeigen pflegt, daß der Erzähler aus dem Zustand des Zuhörers in den des Erzählers übergeht, und sie kam näher. Als alle zu schreien anfingen, sah ich mich nach ihr um, sie bewegte ihre Lippen kaum merklich, ihre Augen aber waren voller Gedanken und voller Leben. Als unsere Blicke sich begegneten, senkte sie die Augen. Nach einer Minute sah ich wieder nach ihr: Sie murmelte wieder etwas vor sich hin. Ich bat sie, mir doch etwas zu erzählen, da wurde sie ganz verlegen. Nach zwei Tagen konnte sie schon ganz vortrefflich ganze Geschichten erzählen. (Pädagogische Schriften II, S. 102)
Sein leidenschaftlicher Kampf gegen elitäres Bildungsgehabe, gegen „Verdummung“ und „Verkrüppelung“ gilt auch den Exzellenzentren seiner Zeit, in denen er Legebatterien der Produktion von Uniformität sieht. All diesen Institutionen liege nämlich, so Tolstoi, der Gedanke zugrunde einer kleinen Anzahl von Menschen zuzugestehen, aus anderen genau solche Menschen zu machen, wie sie wollen. (Pädagogische Schriften I, S. 162) Erziehung ist in seinen Augen Zwangsbildung; ein zum Prinzip erhobenes Streben nach sittlichem Despotismus ((S. 151)) sei eine Art mentaler „Vergewaltigung“.
Sein pädagogisches Prinzip des hellsichtigen „Nichteingreifens“, des behutsamen Sondierens und Forschens nach Potentialen und Ermutigung von Ansätzen eigener Berufungsmöglichkeiten verdiente es auch heutzutage wahr- und ernstgenommen zu werden – ohne dass Befürworter dieser Ideen und Werte diffamierend als „Tolstojaner“ abgestempelt werden. Denn man muss kein „Tolstojaner“ sein, um den wahrhaft weltumspannenden Charakter seiner Mission würdigen zu können. Es ist kein Zufall, dass sich zwischen ihm und Gandhi ein sich über mehrere Jahre erstreckender Briefwechsel über die Prinzipien des gewaltfreien Widerstands entwickelte. Die verwegen erscheinende Vermischung von Krischna-Zitaten, christlichen Maximen und politischer Analyse sollte nicht über die Ernsthaftigkeit des Unterfangens hinwegtäuschen. Er lieferte einen wichtigen Impuls im Verlauf des indischen Kampfes um Autonomie, der 1947 tatsächlich zum Ende der britischen Kolonialherrschaft führen sollte.
Weltsprache Literatur
Weltsprache Literatur
 Über einzelne Werke der Literatur zu schreiben, ist das eine; treffsichere Formulierungen über Literatur als Ganzes – ihr Wesen, ihre Funktion und ihre Verbindung mit anderen gesellschaftlichen Kräften – zu finden, ist dagegen eine besondere Kunst. Jürgen Wertheimer ist prädestiniert dafür. Er ist Professor für Neuere Deutsche Literatur und Komparatistik in Tübingen, ein aufstachelnder Vortragsredner und dabei politisch nicht abstinent. Nun ist also sein gewichtiges Buch über Weltliteratur erschienen, ein Musterbeispiel für vergleichende Literaturbetrachtung. Denn Goethe war gut, aber wer die frische Luft des „Fremden“ geschnuppert hat, dem wird es in der Umzäunung seiner Nationalliteratur schnell zu eng. Er lernt, wie eines zum anderen gehört – ein Netz gegenseitiger Beeinflussung – und wie das universell Menschliche in jeder Maske und kulturellen Färbung durchbricht. (Roland Rottenfußer)
Über einzelne Werke der Literatur zu schreiben, ist das eine; treffsichere Formulierungen über Literatur als Ganzes – ihr Wesen, ihre Funktion und ihre Verbindung mit anderen gesellschaftlichen Kräften – zu finden, ist dagegen eine besondere Kunst. Jürgen Wertheimer ist prädestiniert dafür. Er ist Professor für Neuere Deutsche Literatur und Komparatistik in Tübingen, ein aufstachelnder Vortragsredner und dabei politisch nicht abstinent. Nun ist also sein gewichtiges Buch über Weltliteratur erschienen, ein Musterbeispiel für vergleichende Literaturbetrachtung. Denn Goethe war gut, aber wer die frische Luft des „Fremden“ geschnuppert hat, dem wird es in der Umzäunung seiner Nationalliteratur schnell zu eng. Er lernt, wie eines zum anderen gehört – ein Netz gegenseitiger Beeinflussung – und wie das universell Menschliche in jeder Maske und kulturellen Färbung durchbricht. (Roland Rottenfußer)
„Doch gerade in einer Zeit, in der die Kategorien der Religion unverbindlich bzw. gefährlich, die der Politik unverbindlich bzw. aggressiv, die der Wirtschaft freundlich-destruktiv geworden sind, brauchen wir Welt-Literatur. Und zwar weder als Narkotikum noch als Ersatzreligion noch als elitäres Kulturgehege. Sondern als blickscharfe, sprachgenaue, phrasenfreie Denk- und Wahrnehmungsschule für jede und jeden, der lesen kann und will und muss.“
Komparatisten vergleichen. Literatur mit Literatur. Texte verschiedenster Zeitepochen, Sprachen und Kulturen. Verschiedene Übersetzungen ein- und desselben Gedichts. Manchmal sogar die Literatur mit anderen künstlerischen Genres wie Musik und Malerei. Die Komparatistik als akademischer Zweig macht ein verbreitetes Manko der literaturwissenschaftlichen Arbeit wett, die zugleich auch politisch eher geistesverengend wirkt: die Überbetonung des Nationalen. Warum etwa sollten wir Fontanes grandiosen Gesellschafts- und Ehebruchsroman „Effi Briest“ preisen, Flauberts thematisch verwandten Klassiker „Madame Bovary“ oder Tolstois „Anna Karenina“ dagegen ignorieren, sofern wir die Grenze zwischen den „Nationalliteraturen“ überwinden können: durch Sprachen lernen oder die Verwendung einer Übersetzung?
Da wächst zusammen, was nie hätte getrennt werden dürfen. Weltliteratur ist das Stichwort. Wobei dem vergleichenden Betrachten noch ein viel essenziellerer Schritt vorgeschaltet ist: die Literatur anderer Sprachen und Kulturen überhaupt zur Kenntnis zu nehmen und als prinzipiell gleichberechtigt mit der „eigenen“ anzuerkennen. Das ist vom Prinzip her nichts Anderes, als was Integration und Inklusion heute auf der Ebene des praktischen Handelns von uns verlangen.
Weltliteratur – das bedeutet mehr, als unsere aus Böll, Thomas Mann und Kafka bestehende Lektüreliste gelegentlich durch „Schuld und Sühne“, „Jenseits von Eden“ und eine „Lear“-Aufführung im Stadttheater zu ergänzen. Dies kann es auch bedeuten. Aber wirkliche Kenntnis der Weltliteratur würde erfordern, sich – im Rahmen der verfügbaren Lebenszeit – mit der Literatur Indiens, Chinas und des islamischen Kulturkreises vertraut zu machen. Mit der griechischen Antike ebenso wie mit neueren spannenden Erzeugnissen des südamerikanischen Kontinents: García Márquez und Vargas Llosa etwa. Es bedeutet, nicht nur über den Untertassenrand der Germanistik hinauszuschauen, sondern auch über den darunter liegenden Tellerrand der gut erschlossenen benachbarten europäischen Literaturen.
Ohnehin haben wir es, wie Jürgen Wertheimer sehr deutlich macht, nicht nur mit den nebeneinander gestellten statischen „Blöcken“ der einzelnen Nationalliteraturen zu tun, sondern mit einem fließenden System vitalen Austauschs und gegenseitiger Beeinflussung – vorangetrieben durch die Schreibenden selbst, die in aller Regel auch begeisterte Lesende waren. Selbst wer mit Literaturbetrachtung nur am Gymnasium konfrontiert war, kennt Komparitistik. Wenn er zu seinem Leid- oder Freudwesen z.B. eine Aufgabe wie diese gestellt bekam: „Vergleichen Sie die unterschiedliche Deutung der Jeanne d’Arc-Figur in den Werken von Schiller, Anouilh und Brecht!“
Das war und ist höchst lohnend, so dass Bildungsnahe geneigt sind, Jürgen Wertheimer zuzustimmen, wenn er in seiner Einführung schreibt: „Eine Welt ohne Antigone und Emma Bovary, ohne Werther und Macbeth ist kaum vorstellbar“. Es mag sein, dass dieses Statement ein wenig zu kulturoptimistisch anmutet in einer Zeit, in der Filme wie „Fack ju Göthe“ reüssieren und der Big-Brother-Kultstar Zlatko ungestraft trällern durfte: „Ob nun Shakespeare oder Goethe, die sind mir doch scheißegal“. Aber gerade deshalb gilt es doch, ein Gegengewicht zu schaffen und nicht hinzunehmen, wie sich viele Zeitgenossen in die von Medien und Politik beförderten Verdummungsprozesse gleichsam hineinsinken lassen. Wertheimer vergleich vieles, aber das Triviale und bloß Populäre bleibt als Vergleichsobjekt weitgehend außen vor – ein sinnvoller Akt der Selbstbeschränkung, denn „Weltsprache Literatur“ ist ein im buchstäblichen wie übertragenen Sinn gewichtiges Werk.
Das Frappierende an diesem Buchtitel ist, dass er uns zunächst gar nicht einleuchtet. Die Weltsprache – wenn man es nicht beim Englischen oder bei Esperanto belassen will –, das ist doch vor allem die Musik. Sie überwindet alles Sprachgrenzen, und auch, wer des Italienischen über Urlaubsphrasen wie „Buon giorno“ hinaus nicht mächtig ist, versteht ganz unmittelbar die Schmerzwonnen, von denen die Opernfiguren Puccinis oder Verdis überflutet werden. Hier provoziert Wertheimer gleich zu Anfang: „Weshalb sollte der Begriff Weltsprache Literatur nicht so selbstverständlich sein wie der der Weltsprache Musik?“ Diese Frage mündet als erste Antwort in ein Lob des Geschichtenerzählens. „Ohne die Geschichten und Figuren der Literatur fehlt uns der Schlüssel zum Verstehen der Zusammenhänge, der Bedeutungen, der Zugang zu den Gefühlen und Gedanken der Bewohner dieser Kulissen.“ Die Literatur als Raum- und Zeitkapsel, als Zugang zur Gesamtheit menschenmöglicher Gefühle, Gedanken und Dramen – und zwar weltweit sowie geschlechter- und klassenübergreifend.
Jürgen Wertheimer ist derzeit Professor in Tübingen. Ich selbst habe in seiner Münchner Zeit bei ihm studiert und ihn als rhetorisch mitreißenden Danton der Literaturbetrachtung kennen gelernt. Ich kann denjenigen unter meinen Leserinnen und Lesern, die sich quasi als Mitstudierende Teile der Weltliteratur zu erschließen versuchen, nur raten: Lest es, die Lektüre ist überaus anregend und erhellend. Sie schult in weit ausgreifendem und vernetztem Denken – dies in einer Zeit, die eher Spezialisierung und Geistesverengung als markttaugliche Produktionsfaktoren goutiert.
Literaturwissenschaft ist Widerstand, wenn sie so betrieben wird, also nicht als Museumsrundgang zwischen Stein gewordenen Säulenheiligen des Literaturkanons, sondern als Aufruf, mit und in Literatur zu leben. Mythen mischend und Zerrbilder zertrümmernd, deutet Wertheimer Literatur – auch Jahrhunderten alte – immer als etwas eminent Gegenwärtiges, das uns zum Mitfühlen und Mitdenken, zum schwärmenden, zweifelnden, gelegentlich Denkmäler bepinkelnden Lebensvollzug auffordert. „Doch die Literatur ist nicht nur Archiv der Vergangenheit, sondern auch Wegweiser durch die Gegenwart. Einer plurikulturellen Gegenwart der Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen, des vehementen Aufeinanderprallens von Gegensätzen wie auch universalistischer Vision einer Weltkultur.“
Man erkennt schon an diesem Absatz, dass Wertheimers Buch alles andere als das germanistische Pendant zu Sarrazins „Deutschland schafft sich ab“ sein möchte. Anspruchsvoll und den Wortschatz erweiternd, widersagt es dennoch allem Dünkelhaften, das im ausschließlichen Besteigen Weimarer „Höhenkämme“ läge. Literatur ist immer Anwalt des Einzelnen gegen die ihn vereinnahmenden Manipulations- und Menschenvernutzungssysteme. Denn so verschieden Geschriebenes auch sein mag – „im Kern gibt es eine überraschende Übereinstimmung. Sie ist immer Plädoyer für den Einzelnen, die individuelle Wahrnehmung und das Recht auf mögliche Um- und Irrwege und die fantasievolle Künstlichkeit dessen, was wir ‚Wirklichkeit‘ nennen.“ Man überprüfe dieses Statement anhand beliebiger Literatur-„Helden“ – von Antigone bis Don Quixote, von Eichendorffs „Taugenichts“ bis zu Etienne Lantier, dem Protagonisten von Zolas Sozialroman „Germinal“.
Literatur, wie sie Wertheimer versteht, ist nicht Weltflucht-Hilfe und Anleitung zur beschaulicher Fügsamkeit. Sie repräsentiert vielmehr „einen basisdemokratischen Prozess der Fremd- und Selbsterfahrung, zumeist am äußersten Rand des Erlaubten und Denkbaren.“ Gute Literatur beinhaltet Welt, ohne zur Hinnahme der in dieser Welt vorgefundenen Gegebenheiten zu verführen. „Auch weil sie in diesen Zeiten der mitunter paranoiden Ängste auf den Menschen setzt und dessen Würde – jenseits alles Phrasenhaften – bedingungslos verteidigt.“ Es ist ein großer emanzipatorischer Anspruch, den Wertheimer aus Weltliteratur heraus- und in sie hineinliest.
Einwände vorwegnehmend, rechtfertigt sich der Autor: „Alles, was man gegen dieses Buch vorbringen können wird, kann man auch gegen die ‚Welt wie sie ist‘ vorbringen. Es ist sprunghaft, inhomogen, redselig und fragmentarisch zugleich.“ Eine chrono-logische Vorgehensweise darf man nicht erwarten, wenn etwa Kafkas „Amerika“ dem Gilgamesch-Epos vorausgeht, woraufhin der Autor von „Tausend-und-eine-Nacht“ über Shakespeares „Sturm“ zum indischen Nationalepos „Mahabarara“ springt. „Göttliche Komödie“ (Dante) trifft auf „Menschliche Komödie (Balzac), Odysseus“ (Homer) auf „Ulysses“ (Joyce).
Besonders anregend – und für religiöse Wahrheitsbesitzer irritierend – ist Wertheimers Art, die Brücke zwischen Literatur und Religion zu schlagen. Der erklärte Aufklärer, der sich in politischen Reden nicht scheut, Lessings Ringparabel (aus „Nathan der Weise“) gegen Fanatiker jeglicher Couleur in Stellung zu bringen, stellt die Verbindung auf ziemlich brüske Weise her: Religion ist Kunst, weil sie künstlich ist. „Es gibt Texte, ‚Heilige Texte‘ gibt es natürlicherweise nicht. Heiliggesprochene Texte wurden und werden von Menschen gemacht, genau wie Heilige von Menschen gemacht werden. Und alle Werte, so gottgewollt sie erscheinen, sind aus Worten gemacht, bilden einen Dom aus Worten, wie Nietzsche es benennt.“ Und noch respektloser: „Verlagstechnisch betrachtet ist die Bibel wohl das, was man einen internationalen Longseller nennt“.
Der Autor liest Texte aus der Bibel also, ohne Weihrauchgewölk zu verbreiten. Das ermöglicht einen unvernebelten Blick. Im Einklang mit dem zuvor erwähnten Philosophen bricht er mit Gott, „der mit Abstand wirkmächtigsten menschlichen Kreation.“ Skandalöser noch im Abschnitt über die Evangelien, die Wertheimer nicht dem Bibelkapitel zuordnet, sondern ausgerechnet jenem über orientalische Märchen. „Könnte man das Neue Testament vielleicht sogar als frühen Vorläufer des modernen Romans bezeichnen?“ Die Erzählhaltung multiperspektivisch, der Protagonist unglücklich, gebrochen, dennoch ein „Sympathieträger“, ein Held nachgiebiger Innerlichkeit, stark nicht mit dem Schwert, sondern mit zündender Rhetorik. Natürlich handelt es sich – daran lässt der Literaturexperte keinen Zweifel – bei Jesus um einen erfundenen Helden. „Literatur hat immer etwas mit Schwindel zu tun.“ Da wird dem Leser schwindelig.
Konsequenterweise wird auch der Koran nicht geschont, den der Autor uncharmant mit der Betrachtung des Skandals um Rushdies „Satanische Verse“ kombiniert. Hier setzt Wertheimer gegen den zeitgeistgemäßen „Kulturkampf“ der Abendlandbewahrer das Modell gegenseitiger kultureller Befruchtung, wobei der Strom der Inspiration klar eher von Nahost nach Nordwest floss. „Geht Europa jenseits des Hindukusch weiter, reicht es gar bis zum Hindukusch – wo wir Deutschland verteidigen, um einen gut gemeinten Politikersatz zu zitieren? Oder steckt die erhellende Einsicht dahinter, dass die abendländische Wertegemeinschaft insgesamt das Produkt mittelöstlicher, mediterraner Mythen ist?“ Die leitkulturelle Seinsweise des Mitteleuropäers, so macht Wertheimer klar, ist eine zusammengesetzte, ein Patchwork mehr als ein einheitliches Gebilde, das es mit geistigen Mauern gegen andrängende Osmanenstürme zu verteidigen gälte.
Auch der einseitigen Idealisierung des „Fremden“ enthält sich Jürgen Wertheimer jedoch, wenn dieses dem Grundwert vernünftiger Humanität widerspricht. „Der Westen lässt sich eine Diskussion aufdrängen, die längst nicht mehr die seine ist“, hält er jenen entgegen, die mit überschießender Toleranz selbst die Konzepte islamistischer Glaubensdiktaturen zu verstehen suchen. Da ist Wertheimer ein scharfzüngiger Settembrini wehrhafter Humanität. „Was in aller Welt bringt uns eigentlich dazu, Religionszugehörigkeit zur obersten Richtschnur des politischen Daseins zu machen?“ Im Koran dominiere „der Ton der Alternativlosigkeit, eines Diktats, das keine Ausreden gelten lässt.“
Das Potenzial von Mohammeds Werk liege jedoch im Prozesshaften, teils Widersprüchlichen seiner Darstellungsweise, „das dazu führen könnte, diesen Texte aus seiner ideologischen Versteinerung herauszulösen und zu beleben – jenseits dogmatischer Verhärtung.“ Und in der Summe: „‘Heilige Texte‘ wieder als literarische Texte zu lesen würde eine Befreiung von den Fesseln des Dogma darstellen. Welche Erweiterungsmöglichkeit, welche wahrhafte ‚Befreiungstheologie‘ erwüchse aus diesem Geist.“ Literatur gegen Wahrheitsanmaßung und Seelenverknöcherung – ein kühnes und zugleich einleuchtendes Konzept: „Weder ‚Kulturen‘ noch Geschichten existieren als abgeschlossene Entitäten. In diesem Sinne könnte ‚Weltliteratur‘ den Umstand bezeichnen, dass es keinen allumfassenden und alleingültigen Deutungsanspruch für Geschichten geben kann.“ Sind nicht tatsächlich die multiperspektivischen Geschichten immer die besten? Goethes Erzählgedicht „Erlkönig“ etwa, das dem anmaßenden „Es ist wahr!“ ein wägendes „Ist es wahr?“ entgegensetzt.
Literatur ist welthaltig und wirkt zugleich mitgestaltend auf die Welt ein. Niemals aber reduziert Wertheimer Literatur auf eine Funktion ähnlich dem holzschnittartig argumentierenden politischen Pamphlet. Immer hat die „Kunst“ ihr Eigenrecht und wirkt gerade darin befreiend, weil wahrnehmungsschulend und bewusstseinsweitend. Mit Tolstoi stellt der Autor in den Raum, „dass der ästhetischen Qualität nichts abträglicher ist als das Einsickern gesinnungs- und bekenntnishafter Momente.“ Tolstoi, der große Weltengestalter, der zugleich zum Weltverbessernd-Thesenhaften neigte und das Spannungsfeld zwischen Ästhetik und Engagement somit beispielhaft repräsentiert.
In seinem Aufsatz „Was ist Kunst?“ behauptete der russische Großschriftsteller – darin Wertheimer vorausgehend: „Die Kunst ist nicht, wie die Metaphysiker sagen, die Offenbarung irgendeiner geheimnisvollen Idee, der Schönheit Gottes; (…) vor allem aber ist sie kein Genuss, sondern ein für das Leben und das Streben auf das Wohl des einzelnen Menschen und der Menschheit notwendiges Mittel der Einigung der Menschen, das sie in ein und denselben Gefühlen vereinigt.“
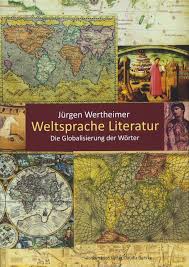
Buchtipp:
Jürgen Wertheimer: Weltsprache Literatur. Die Globalisierung der Wörter. Verlag Claudia Gehrke. 450 Seiten, € 19,90

